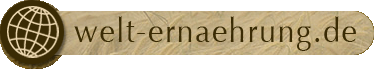Französische Wissenschaftler widerstehen Monsanto
Genmais: nicht koscher
Französische Wissenschaftler widerstehen Monsanto. Ihre Studie wies bei Ratten Gesundheitsschäden durch Verzehr einer manipulierten Sorte nach. Sie wird seither vergeblich als unseriös diffamiert
Von Peter Clausing
Vor knapp einem Jahr, am 19. September 2012, veröffentlichte Professor Gilles-Eric Séralini von der Universität Caen, Nordfrankreich, zusammen mit sieben weiteren Autoren in der Fachzeitschrift Food and Chemical Toxicology die Ergebnisse einer Langzeitstudie. Dabei wurden krebserregende Wirkungen und andere Gesundheitsschäden an Ratten nachgewiesen, nachdem diese 24 Monate lang mit gentechnisch verändertem NK603-Mais gefüttert wurden. Die Publikation schlug ein wie eine Bombe, denn sie stellt die laxe Risikobewertung für gentechnisch modifizierte (GM) Pflanzen, wie sie bislang von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und anderswo praktiziert wird, in Frage.
Eine Verschärfung der Prüfvorschriften würde die Zulassung von GM-Sorten deutlich erschweren und das Zulassungsverfahren für sie generell verlängern und verteuern. Außerdem müßten auch bereits zugelassene, positiv getestete Sorten vom Markt genommen und aufwendig neu bewertet werden. Genau dies forderten im vergangenen Jahr französische Spitzenpolitiker nach Erscheinen der Studie. Erwartungsgemäß heftig fiel die Reaktion der Gentechnikindustrie und -lobby aus. Innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung des Artikels entfaltete sich im englischen Sprachraum eine über diverse Medien verteilte Diffamierungskampagne, in der die Zeitschrift unter anderem zur Rücknahme des Artikels aufgefordert wurde. Zwar wurde dies nicht erreicht, aber es muß als Erfolg der Gentechniklobby gewertet werden, daß bei Food and Chemical Toxicology wenige Monate später der Posten eines speziellen Herausgebers für Publikationen zum Thema Biotechnologie geschaffen – und mit einem ehemaligen Monsanto-Mitarbeiter besetzt wurde. Ein zweites Ziel war die Diskreditierung Séralinis und seiner Kolleginnen und Kollegen. Beides folgte einem Muster, das schon bei früheren gentechnikkritischen Artikeln angewendet wurde. So berichtete der ungarische Wissenschaftler Arpad Pusztai bereits 1999 zusammen mit Stanley Ewen über Immunschäden nach Fütterung von GM-Kartoffeln an Ratten. Dies kostete ihn seinen Job am Rowett Research Institute im schottischen Aberdeen. 2005 erhielt er den Whistleblower-Preis der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler. Ähnliches widerfuhr Ignacio Chapela, als er zusammen mit seinem Doktoranden David Quist im Jahr 2001 aufdeckte, daß sich, bis dahin unbemerkt, GM-Mais im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca ausbreitete. Chapela konnte seinen Verbleib an der Universität Berkeley gerichtlich ertrotzen, seine in der renommierten Zeitschrift Nature erschienene Publikation wurde jedoch unter dem Druck der Gentechniklobby von deren Herausgeber nachträglich für ungültig erklärt.
Labor Séralini hält stand
Im Fall von Séralini funktionierte dieses Spiel nicht, wenn man von der erwähnten Installation des Biotechnologieexperten bei Food and Chemical Toxicology absieht. Der Professor und sein Team hatten von Anbeginn die Solidarität eines breiten Kreises von Akademikern, was bei solchen über die »Wissenschaftsschiene« geführten Auseinandersetzungen besonders wichtig ist. Über die stark besuchte, mehrsprachige Website wird den Angriffen transparent und offensiv begegnet.
Und erstmals in der Geschichte der Kontroversen um die Folgen der Genmanipulation an Organismen reagierte die Politik, wenngleich ziemlich halbherzig: In Frankreich gibt es seit dem 12. Juli 2013 eine Ausschreibung für die Etablierung eines Konsortiums zur »Untersuchung der gesundheitlichen Auswirkungen des Langzeitverzehrs von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln«, dem 2,5 Millionen Euro Forschungsmittel zur Verfügung stehen sollen. Und die EU-Kommission lobte bereits im Juni eine mit drei Millionen Euro dotierte Studie zur Untersuchung der krebserzeugenden Wirkung von NK603-Mais aus, deren Beginn für 2014 geplant ist. Halbherzig sind beide Entscheidungen insofern, als im Sinne eines verantwortungsbewußten Risikomanagements die im Jahr 2004 erteilte Zulassung für NK603 als Nahrungsmittel so lange suspendiert werden müßte, bis die geplante Kanzerogenitätsstudie ausgewertet ist.
Erschütterte Fundamente
Die Ergebnisse von Séralini werden unter anderem deshalb so aggressiv bekämpft, weil sie an den Grundfesten der Argumentation der Gentechnikindustrie rütteln. Diese lautet, daß GM-Pflanzen zwangsläufig ohne Nebenwirkungen sein müssen, da es sich ja nur um eine Beschleunigung »natürlicher Veränderungen« ihrer genetischen Konstitution handele, ähnlich, wie sie im Verlaufe der Evolution ohnehin passieren würden. Auf Basis dieser Philosophie beklagen die Gentechnikbefürworter zu jedem sich bietenden Anlaß selbst das von der EFSA geforderte Minimalprogramm einer Sicherheitsbewertung als Schikane, die ihnen die Gegner des biotechnologischen Fortschritts eingebrockt hätten. Dabei kann den Saatgutkonzernen auf Antrag sogar ein Teil der für bestimmte GM-Pflanzen empfohlenen Sicherheitsprüfungen erlassen werden. Das ist ein gravierendes Problem, zumal zahlreiche Mitglieder der Entscheidungsgremien dieser EU-Zulassungsbehörde Interessenkonflikte aufgrund ihrer Beziehungen zu GM-Produzenten haben, wie Anfang 2012 von Corporate Europe Observatory, einer in Brüssel ansässigen Nichtregierungsorganisation, dokumentiert wurde. Deshalb stellt die für NK603 ausgelobte Studie, die weit über die in der EFSA-Richtlinie von 2011 geforderten Prüfungen hinausgeht, einen Sieg jener kritischen Wissenschaftler dar, die seit Jahren strengere Maßstäbe für das Zulassungsverfahren einfordern.
Noch im Dezember sträubte sich die EFSA grundsätzlich gegen Langzeitstudien zu GM-Pflanzen. Erst unter dem Druck der Ereignisse scheint in der Behörde ein Sinneswandel einzutreten: Neben den – von EFSA-Vertretern offiziell als unzureichend bezeichneten – Ergebnissen aus dem Labor Séralini fällt offenbar die mittlerweile von neun EU-Ländern ausgesprochene Rücknahme der Zulassung für die GM-Mais-Sorte MON 810 ins Gewicht.
Aber auch aus molekularbiologischer Sicht gibt es allen Grund, die Anforderungen für die Zulassung von GM-Pflanzen zu revidieren. So konnte ein Forscher-Team um den chinesischen Professor Chen Yu Zhang von der Nanjing-Universität sogenannte Mikro-RNA von Pflanzen im menschlichen Blut nachweisen. Dies ist ein Beleg dafür, daß diese genetischen Steuermoleküle in der Lage sind, die menschliche Darmwand zu passieren und so auf Gene einzuwirken. Die Forschung von Chen Yu Zhang und Kollegen ist darauf ausgerichtet, die molekularbiologischen Mechanismen der traditionellen chinesischen Medizin aufzuklären. Gleichwohl weist die Tatsache, daß pflanzliche Mikro-RNA in den menschlichen Körper gelangen kann, auf noch näher zu untersuchende Risiken durch Nahrungsmittel mit genmanipulierten Komponenten hin.
Es ist also höchste Zeit, daß die Vorschriften für die Zulassung von GM-Pflanzen den verschiedenen neuen Erkenntnissen Rechnung tragen. Außerdem muß eine Unabhängigkeit der Sicherheitsprüfungen und ihrer Bewertung gewährleistet sein. Zugleich muß sichergestellt werden, daß – dem Verursacherprinzip folgend – die Unternehmen für die entstehenden Kosten aufkommen. Es bleibt zu hoffen, daß dafür gesorgt wird, bevor »das Kind in den Brunnen gefallen ist«. Denn auch vor der 1961/62 aufgedeckten Contergan-Tragödie vertraten die Pharmakonzerne und Behörden die Ansicht, bestimmte Tests seien nicht notwendig. Im Fall der Gentechnik wird sich bei näherem Hinsehen zudem erweisen, daß sich der Aufwand gar nicht lohnt, denn mit effizienten agrarökologischen Anbauverfahren und nicht zuletzt mit moderner konventioneller Züchtung, wenn deren Ergebnisse nicht Profitinteressen dienen, ist der Menschheit weitaus mehr gedient als mit aus GM-Pflanzen bestehenden Monokulturen.
Im September erscheint im Unrast-Verlag Peter Clausings neues Buch »Die grüne Matrix. Naturschutz und Welternährung am Scheideweg«
Erschienen in junge Welt, Beilage Land & Wirtschaft v. 7.8.2013