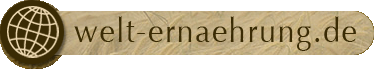Der Ukraine-Krieg und die Welternährungskrise
Zwölf Tage nach Beginn des Krieges, am 08. März, publizierte die Welternährungsorganisation (FAO) eine 40-seitige Analyse, die sich mit den Risiken befasste, die aus dem Ukraine-Krieg für die globale Lebensmittelversorgung ergeben könnten und gab einen düsteren Ausblick. Ausgangspunkt der Überlegungen war der Umstand, dass in den Jahren zuvor aus Russland und der Ukraine zusammengenommen 30 Prozent der globalen Weizenexporte und über Hälfte der Exporte von Sonnenblumenkernen bzw. -öl kamen, außerdem Mais und Gerste. Hinzu kommt, dass die Russische Föderation Platz 1 beim Export von Stickstoffdüngern und Platz 2 beim Export von Phosphor- und Kalidünger einnimmt. Bezogen auf die globale Exportmenge lag der Anteil Russlands laut FAO-Statistik in den letzten Jahren für alle drei Pflanzennährstoffen grob gerechnet jeweils zwischen 10 und 15 Prozent. In 25 Ländern betrug der Anteil aus Russland importierter Düngemittel bei 30 Prozent und mehr. Die Synthese von Stickstoffdünger erfolgt fast ausnahmslos unter Verwendung von Gas in einem extrem energieintensiven Prozess, dem Haber-Bosch-Verfahren. Die hohen Gaspreise schlugen sich...
Lesezeit: 8 MinutenViel Macht für wenige
Unter dem Titel »Wer hat die Macht?« wurde anlässlich des G-7-Gipfels eine Studie des Fair Trade Advocacy Office Brüssel zu Machtkonzentration und unlauteren Handelspraktiken in diesen Wertschöpfungsketten vorgelegt. Von Peter Clausing Wenn sich am 7. und 8. Juni die Staats- und Regierungschefs der G-7-Länder auf Schloss Elmau in Oberbayern treffen, wird auch die Gestaltung von Handels- und Lieferketten ein Gesprächsthema sein. Diese Strukturen werden gern als Wertschöpfungsketten bezeichnet, was suggeriert, dass alle Beteiligten etwas abbekommen. Besonders jene Prozesse, die unsere Ernährung berühren, spielen eine wichtige Rolle. Doch die »Wertschöpfung« ist ungleich verteilt. Am einen Ende der Kette befinden sich 2,5 Milliarden Menschen, deren Einkommen von der Landwirtschaft abhängt. Ein Großteil von ihnen trägt dazu bei, dass die globalen Warenströme fließen, oder wird von diesen beeinflusst. Am anderen Ende: 3,5 Milliarden Menschen, die in Städten leben und folglich ihre Lebensmittel kaufen müssen. Dazwischen agieren diejenigen, die den überwiegenden Teil des (Mehr-)Wertes abschöpfen: die Händler, die Aktionäre der Agrar- und Lebensmittelindustrie und...
Lesezeit: 3 MinutenLandungerechtigkeit: Hunger und Migration
Der chronische Nahrungsmangel im subsaharischen Afrika hängt mit der Ungleichheit im Besitz von Grund und Boden zusammen. Eine Abwanderung in die Städte lindert die Not in der Regel nicht. Von Peter Clausing In den Ländern südlich der Sahara, dem sogenannten subsaharische Afrika, leben über 200 Millionen chronisch hungernde Menschen – das sind etwa 30 Prozent der dortigen Bevölkerung. Davon sind vor allem die auf dem Land lebenden Menschen betroffen, für die »chronischer Hunger« zumeist bedeutet, dass er alljährlich wiederkehrt, nämlich dann, wenn die eigenen Vorräte zur Neige gehen und das Geld nicht reicht, um zusätzliche Lebensmittel zu kaufen. Diese Periode kann mehrere Wochen bis mehrere Monate dauern – je nachdem wie die vorherige Ernte ausfiel. Typisch ist das für Betriebe, bei denen die landwirtschaftlich bearbeitete Fläche unter einer Größe von zwei Hektar liegt. 80 Prozent der afrikanischen Bäuerinnen und Bauern bewirtschaften derart kleine Flächen und ernähren damit mehr schlecht als recht eine oftmals sechs- bis achtköpfige Familie. In Malawi zum...
Lesezeit: 9 MinutenEin diskursives Hungergespenst
von Peter Clausing Nicht selten ruft die Frage, ob und unter welchen Bedingungen die wachsende Weltbevölkerung ausreichend ernährt werden kann, Ratlosigkeit und Unbehagen hervor. Eine negative Antwort würde den Hungertod Hunderter Millionen Menschen mit kaum vorstellbaren gesellschaftlichen Folgen bedeuten. Schließlich sind schon heute zirka 850 Millionen Menschen unterernährt, was bedeutet, dass alljährlich etwa 10 Millionen Menschen an Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen sterben. Die Frage, was getan werden müsste, um bei gleichzeitig wachsender Weltbevölkerung von diesem Genozid wegzukommen, wird sehr unterschiedlich beantwortet. Zunächst ist festzuhalten, dass ein allgemeiner Konsens darüber besteht, dass die Weltbevölkerung nach 2050 nur noch unwesentlich zunehmen wird. Zwar werden in 35 Jahren voraussichtlich zwei Milliarden (30 Prozent) mehr Menschen auf der Erde leben als heute, jedoch bei stetig abnehmendem Bevölkerungswachstum. Nun vertreten Weltbank und Welternährungsorganisation (FAO) die Ansicht, dass dann, wenn 30 Prozent mehr Menschen die Welt bevölkern, 70 Prozent mehr Nahrungsmitteln zur Verfügung stehen müssten. Die Diskrepanz zwischen den 70 und 30 Prozent wird mit...
Lesezeit: 3 MinutenSanamadougou und Sahou müssen bleiben: Landraub stoppen – in Mali und überall sonst!
August 2014: Internationaler Appell der europäischen Sektion von Afrique-Europe-Interact [*] Anfang 2013 ist Mali kurzzeitig in die internationalen Schlagzeilen geraten. Islamistische Milizen hatten den Norden des Landes besetzt, es folgte eine internationale Militärintervention unter Führung Frankreichs, in deren Verlauf zumindest größere Städte wie Timbuktu und Gao befreit werden konnten. Und doch hat sich das Leben für die Masse der Bevölkerung kaum verändert – weder im Norden noch in den übrigen Landesteilen. Besonders dramatisch ist die soziale Lage von Kleinbauern und -bäuerinnen, die ungefähr 75 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Stellvertretend dafür stehen die beiden Dörfer Sanamadougou und Sahou 270 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bamako. Noch im Jahr 2009 haben diese zur Linderung einer landesweiten Ernährungskrise 40 Tonnen Hirse an die malische Regierung gespendet, heute sind sie selber auf Lebensmittellieferungen angewiesen. Denn im Zuge des weltweit boomenden Ausverkaufs fruchtbarer Acker-, Wald- und Weideflächen an Investmentfonds, Banken und Konzerne ist es auch in Sanamadougou und Sahou zu gewaltsamen Vertreibungen gekommen. Zudem mussten die...
Lesezeit: 5 MinutenNaturschutz als Landraub – Betrachtungen zum Tag der Menschenrechte
Nationalparks bewahren die biologische Vielfalt. Gleichzeitig aber werden die dort lebenden Menschen verdrängt und ihrer Existenzgrundlage beraubt. Von Peter Clausing Am 10. Dezember wird alljährlich der Tag der Menschenrechte begangen. 1948 wurde an diesem Datum die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Nicht selten wird an diesem Tag vorrangig über die bürgerlichen und politischen Menschenrechte öffentlich nachgedacht, zu denen das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht auf Versammlungsfreiheit und das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit zählen. Es ist auch der Todestag Alfred Nobels, der 1894, zwei Jahre vor seinem Ableben, den schwedischen Rüstungsbetrieb Bofors kaufte. Nichtsdestotrotz wird seit 1901 am 10. Dezember der Friedensnobelpreis vergeben. Neben den bürgerlichen und politischen Menschenrechten sind die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen (WSK-) Rechte ein anderer, ebenso wichtige Teil von Menschenrechten. Für beide Gruppen trat im Jahr 1976 jeweils ein internationaler Pakt in Kraft, in dem die betreffenden Rechte verbindlich beschrieben sind. Zu den WSK-Rechten zählt das im Artikel...
Lesezeit: 10 MinutenNeue DVD: Über den Tellerrand – Ernährungssouveränität in Zeiten des Klimawandels
“Ernährungssouveränität” ist die zentrale Forderung der kleinbäuerlichen Bewegungen in Bangladesch. Angesichts von Klimawandel, Flächenknappheit und Landkonflikten setzen sie sich für eine gerechte Landverteilung und eine selbstbestimmte Agrarproduktion ein. Eigene Parzellen sowie kulturell und ökologisch angepasstes Saatgut sehen sie als Basis für die Nahrungsmittelversorgung. Die Bewegungen verfolgen ihre Ziele gegebenenfalls mit radikalen Mitteln: Sie besetzen und bewirtschaften Land, das ihnen laut Gesetz zusteht, aber aufgrund von Korruption nicht übertragen wird. Der Anbau für den Eigenbedarf und die lokalen Märkte wird durch die Kapitalisierung des Agrarsektors stark gefährdet. Seit der “Grünen Revolution” in den 1960er Jahren nimmt der Einfluss von Saatgut- und Chemiekonzernen beständig zu. Die Abhängigkeit von Dünger, Pestiziden und modifizierten Samen sowie die infrastrukturellen Eingriffe durch Staat und Weltbank haben die Lebensbedingungen der Kleinbäuerinnen und -bauern verändert. Höhere Produktionskosten und sinkende Bodenfruchtbarkeit sind die Schattenseiten der gesteigerten Ernten, die viele in die Verschuldung treibt. Heute gelten drei viertel aller Bangladeschis offiziell als landlos und haben laut “Kash-Land-Gesetz” Anspruch auf eigene...
Lesezeit: 2 MinutenKleinbauern leisten Widerstand
La Vía Campesina ist in diesem Jahr 20 Jahre alt geworden Von Peter Clausing In der mit Tränengas gesättigten Luft von Seattle im Dezember 1999 dankten die Frauen von Vía Campesina der Welthandelsorganisation (WTO): Die Repressionsmaßnahmen während des WTO-Gipfels hätten die zahlreich zu den Protesten erschienenen KleinbäuerInnen zusammengeschmiedet. Auch wurde die globale Föderation widerständiger LandwirtInnen erst durch die Massenproteste und die Polizeigewalt gegen AktivistInnen in Seattle weltweit sichtbar, obwohl Vía Campesina schon sechs Jahre zuvor gegründet worden war. Damals hatten Indigene und LandarbeiterInnen den Paradigmenwechsel erkannt, den Anfang der 1990er Jahre die Aufnahme landwirtschaftlicher Themen in die Verhandlungen des GATT-Abkommens (General Agreement on Tariffs and Trade) bedeutete. 1993 trafen sich daher 46 von ihnen im belgischen Mons und gründeten einen gemeinsamen Dachverband. Die im GATT-Abkommen getroffenen Vereinbarungen legten den Grundstein für die marktbasierte Zerstörung jener agrarpolitischen Strukturen und Programme, die die BäuerInnen in den Jahren zuvor in verschiedenen Ländern erkämpft hatten. Vía Campesina propagierte schon damals eine Landwirtschaft, die ökologisch...
Lesezeit: 3 MinutenSprengt die Wertschöpfungsketten !!
Von Peter Clausing Den offiziellen Start von vier Großprojekten des »German Food Partnership«-Programms (GFP) am 5.11.2013 nahmen mehrere Nichtregierungsorganisationen zum Anlass, diese »Entwicklungspolitik im Dienst deutscher Konzerne« scharf zu kritisieren. Das Forum Umwelt und Entwicklung forderte, »das FDP-Projekt unverzüglich zu stoppen«, und Jan Urhahn, Landwirtschaftsexperte des entwicklungspolitischen Netzwerks INKOTA, hob hervor, daß die Bundesregierung mit GFP unter dem Deckmantel von Hunger- und Armutsbekämpfung einseitig die Wirtschaftsinteressen deutscher und europäischer Unternehmen wie BASF, Bayer Crop Science oder Syngenta bediene. Neben den transnationalen Agrarkonzernen finden sich unter den zehn GFP-Partnern auch die Handelskette Metro, der Verband der Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen und die Düngemittelindustrie. Bereits die Zusammensetzung dieser »Partnerschaft« lässt erkennen, dass es um die Schaffung vertikal integrierter Wertschöpfungsketten geht, bei denen bekanntlich der Wert vor allem am unteren Ende der Kette von den Bäuerinnen und Bauern geschaffen und dann schrittweise nach oben transferiert wird. Mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 78 Millionen Euro werden eine »Kartoffel-Initiative«, eine »Ölsaaten-Initiative« und eine »Konkurrenzfähige Reis-Initiative« in...
Lesezeit: 3 MinutenBill Gates in Afrika
Diesen Beitrag gibt es auch auf Französisch und Spanisch Seit 2006 bemüht sich, relativ wenig beachtet, die „Allianz für eine Grüne Revolution in Afrika“, den profitablen Teil der afrikanischen Landwirtschaft in den Weltmarkt zu integrieren. Hinzu kommt, dass parallel dazu, ebenfalls in Afrika, seit 2010 versucht wird, eine wichtige Komponente agrarökologischer Anbauverfahren unter private Kontrolle zu bringen – die biologische Anreicherung von Stickstoff im Boden. Wiederum gehört die Bill & Melinda Gates-Stiftung zu den Hauptakteuren. Von Peter Clausing TEIL I Zugegeben, Revolutionen sind aus der Mode gekommen. Dabei wäre eine grüne Revolution, die diesen Namen tatsächlich verdient, in Afrika bitter nötig. Denn einerseits ist für 200 Millionen der dort lebenden Menschen Hunger eine täglich Realität, andererseits ist das Potential vorhanden, Afrikas Bevölkerung jetzt und auch perspektivisch mit Hilfe agrarökologischer Anbauverfahren zu ernähren.1 Doch die grüne Revolution, an die wir denken, wenn wir diesen Begriff hören, hatte Afrika niemals erreicht. Die »Grüne Revolution« Die Geschichte des Begriffes »Grüne Revolution« geht bis...
Lesezeit: 19 Minuten