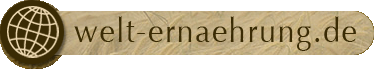Schwein gehabt – Profit gemacht. Mastfabriken zwischen Profitzwang und Protesten
von Peter Clausing
Lunapark21 Nr. 25; März 2014
Man nennt sie heute im angelsächsischen Fachjargon CAFOs – Concentrated Animal Feeding Operations. Eher banal und etwas direkter: Es geht um Mastfabriken. Und damit um riesige, global aktive Fleischkonzerne, von denen 2013 oder 2014 erstmals einer, der chinesische Riese Shuanghui International Holding, der 2013 den US-Fleischriesen Smithfield übernahm, zur Gruppe der 500 größten Konzerne der Welt, der „Global 500“, vorstoßen dürfte.
CAFOS nutzen, ähnlich wie andere Industriezweige, billige Arbeitskräfte und niedrige bzw. nicht durchgesetzte Umweltstandards, um mit Niedrigpreisen im herrschenden Konkurrenzkampf bis zum Erreichen einer Monopolstellung profitabel zu bleiben. Das führt dazu, dass Mastfabriken bevorzugt in Regionen errichtet werden, wo zuvor die lokale Ökonomie zerstört wurde: Dort sind die Arbeitskräfte eher bereit, zu niedrigen Löhnen zu arbeiten; die zuständigen Behörden drücken im Bemühen, Investoren anzulocken, bei den Umweltauflagen gern mal ein Auge zu. Oder das betreffende Land verfügt erst gar nicht über halbwegs angemessene Regularien. Innerhalb der Europäischen Union existieren zwar diverse Umweltschutzgesetze, aber sie werden häufig verletzt – im besonderen Maß in Peripherie-Regionen. Früher war dies vor allem in den mediterranen europäischen Ländern der Fall. So fanden laut einer von Tania Borzel im Jahr 2003 veröffentlichten Studie 42 Prozent der registrierten EU-Umweltvergehen in Griechenland, Italien, Portugal und Spanien statt. Mit der EU-Osterweiterung verlagerte sich der geographische Schwerpunkt in diese Himmelsrichtung. CAFOs leisten dazu ihren Beitrag. Beispielhaft ist die „Migration“ holländischer und dänischer Schweineproduzenten, die so den strengeren Umweltgesetzen in ihren Herkunftsländern entfliehen. Zu diesen „Wirtschaftsflüchtlingen der anderen Art“ gehören der dänische Unternehmer Claus Baltersen, der sein Glück in Litauen versuchte, das dänische Konsortium Poldanor in Polen und mehrere holländische Agrarindustrielle, die vor allem in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt aktiv sind.
Standortvorteile: Billiglöhne und schwache Umweltgesetze
Bei den CAFOs gibt es allerdings eine Besonderheit, die sie von anderen Investitionen unterscheidet: In kaum einer anderen Branche dürfte der lokale Widerstand gegen Direktinvestitionen so häufig anzutreffen sein wie bei Mastfabriken. Die mit dem Angebot der „Schaffung von Arbeitsplätzen“ Beglückten erkennen sehr bald und oftmals rechtzeitig bevor es überhaupt zur Investition kommt, dass mit den wenigen entstehenden Arbeitsplätzen erhebliche Probleme für Umwelt und Gesundheit verbunden sind. Es überrascht dann kaum, dass sich die „Schaffung von Arbeitsplätzen“ zudem als Mogelpackung entpuppt. Laut Statistischem Bundesamt nahm die Zahl der in Deutschland gehaltenen Schweine von 25,6 Millionen im Jahr 2004 auf 28 Millionen im Jahr 2013 zu. Im vergleichbaren Zeitraum hat sich die Zahl der Schweine haltenden Betriebe nahezu halbiert. Auch wenn die spezifische statistische Basis eher mager ist, so dürfte dieser Konzentrationsprozess mit einem erheblichen Verlust von Arbeitsplätzen verbunden sein. Dafür spricht der kontinuierliche Rückgang der Zahl der in der Landwirtschaft insgesamt Beschäftigten und der hohe Mechanisierungsgrad der Großbetriebe.
Der Widerstand gegen Schweinemastfabriken hat oft höchst praktische Ursachen. Studien belegen, dass der von ihnen ausgehende Gestank nicht nur unangenehm ist, sondern auch langfristige psychosomatische Auswirkungen hat, die sich in Angstzuständen, Depressionen und in stressbedingter Immunsuppression manifestieren. Unter Extrembedingungen, wie sie im Perote-Tal im mexikanischen Bundesstaat Veracruz herrschen, wachen die Kinder der Anrainer nachts gelegentlich mit Brechreiz auf, so dass manche Eltern mit ihnen in eine entferntere Gegend mit sauberer Luft fahren, um den Rest der Nacht auf der Ladefläche ihres Pickup-Trucks zu verbringen. Epidemiologische Untersuchungen zeigen ein häufigeres Auftreten von Atemwegserkrankungen und Asthma bei Beschäftigten in den Mastanlagen und bei Menschen, die in Nachbarschaft zu Mastfabriken leben. Diese Erkrankungen werden durch die erhöhten Konzentrationen von „Bioaerosolen“ – durch die Mastanlage emittierte Kot- und Hautpartikel – ausgelöst. Die Verunreinigung von Grundwasser, Oberflächengewässern und des Bodens sind ein seit langem bekanntes Problem. Amerikanischen Angaben zufolge verursacht ein Schwein in einer Mastfabrik bis zu fünfmal mehr Abwasser als ein Mensch in seiner Wohnung. Damit die Umwelt nicht kontaminiert wird, wäre eine gigantische Abwasserbehandlungsanlage notwendig, die umso seltener anzutreffen ist, je weiter die Anlage in der „sozialökonomischen Peripherie“ angesiedelt ist. Die Haßlebener Bürgerinitiative „Kontra Industrieschwein“ berechnete für die dort ursprünglich geplante Kapazität von 85000 Schweinen mit 3,25 Mastdurchgängen, also über 275000 Schlachtschweinen pro Jahr, eine jährliche Güllemenge von 190000 Kubikmetern. Das entspricht der Menge menschlicher Exkremente in einer Stadt mit knapp 200000 Einwohnern. Statistiken wie diese verdeutlichen, warum sich Widerstand gegen Mastfabriken relativ leicht mobilisieren lässt – zumal hier Tierschutzinitiativen als Verbündete eine wichtige Rolle spielen.
Standortvoraussetzung: Zerstörte Ökonomien
Zu den Regionen mit zuvor zerstörten lokalen Ökonomien zählen einerseits die Länder des ehemaligen sozialistischen Lagers (einschließlich der neuen Bundesländer), aber auch das vom Freihandelsabkommen NAFTA gebeutelte Mexiko und etliche strukturschwache Regionen kapitalistischer Kernländer. Im sogenannten „Black Belt“, einem hauptsächlich von Schwarzen bewohnten Gürtel des US-amerikanischen Bundesstaates North Carolina, wo früher die Produktion von Tabak und Baumwolle dominierte, stieg nach dem Preisverfall für diese Cashcrops die Zahl der dort gehaltenen Mastschweine rasant an. Im Jahr 1991 wurden dort 3,7 Millionen Schweine gemästet, gegenüber 10 Millionen im Jahr 1998 – ein Niveau, das im Großen und Ganzen auch zehn Jahre später noch vorherrschte.
Ostdeutschland und die osteuropäischen Länder haben bezüglich Mastfabriken eine Vorgeschichte aus der Zeit des „real existierenden“ Sozialismus. Ausgehend von Partei-Beschlüssen der KPdSU, die sich bis in die Zeit Nikita Chruschtschows zurückverfolgen lassen, wurde im gesamten Ostblock schrittweise die „industriemäßige“ Landwirtschaft eingeführt. Schweinemastfabriken waren Teil dieser Entwicklung. Mit dem Zusammenbruch des Systems zerfiel auch die Mastindustrie. Das Ergebnis war ein sozioökonomischer Wandel von beträchtlichem Ausmaß. So wurden in Litauen 1998 nur noch 40 Prozent so viel Schweine geschlachtet wie 1991. Auf der Mikroebene stellt sich diese Veränderung noch dramatischer dar, denn weit über die Hälfte der dann noch gemästeten Schweine wurde in privaten Haushalten aufgezogen. Mit durchschnittlich 2,8 Schweinen pro Familie wurden in diesem Land in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre rund 630000 Schweine hauptsächlich für den Eigenbedarf gehalten – ein Beispiel für die „stille Ernährungssouveränität auf dem postsowjetischen Territorium“, von der am 24. Januar 2014 auf einem Symposium in Den Haag die Rede war. Mit diesem Wandel ging eine „bedeutende Verbesserung der Umweltbedingungen“ einher, wie von einschlägigen Publikationen bescheinigt wurde. Trotzdem lagen auch 15 Jahre nach Stilllegung der Mastfabriken die Nitratkonzentrationen im Grundwasser ihrer Umgebung noch fünf- bis zehnfach über dem zulässigen Grenzwert. Die relative Aussöhnung mit der Umwelt in den ehemaligen Mast-Standort-Regionen wird seit Mitte der 1990er Jahre von den Begehrlichkeiten westlicher Schweinefleischproduzenten gestört.
Polen genoss zu Zeiten des Staatssozialismus den Ruf, dass dort die kleinbäuerlichen Strukturen weitgehend unangetastet blieben. Das trifft im Prinzip zu, aber der Westen und der Nordwesten des Landes bildeten eine Ausnahme. Hier wurden in den 1970er Jahren große staatseigene Schweinebetriebe errichtet, die sich nach dem Zusammenbruch des Systems als Übernahmeobjekte anboten. Seit 1994 traten hier vor allem zwei Akteure in Erscheinung – das dänische Konsortium Poldanor sowie der globale Marktführer, der US-amerikanische Fleischkonzern Smithfield, dessen polnische Niederlassung unter dem Namen Agri Plus firmiert. (Smithfield selbst wurde, wie erwähnt, Ende 2013 von dem noch größeren chinesischen Schweinefleischproduzenten Shuanghui International Holding Ltd übernommen).
Während das aus 50 dänischen Agrarunternehmern bestehende Konsortium Poldanor ab 1994 begann, still gelegte ehemalige Staatsbetriebe und Schlachthöfe zu pachten oder aufzukaufen, kaufte Agri Plus ausschließlich Schlachthöfe und versuchte, Schweine mästende polnische Bauern unter Vertrag zu nehmen. Inzwischen verkauft das auf Vermehrungszucht spezialisierte Unternehmen Poldanor pro Jahr etwa 350000 Läufer (Jungschweine zwischen 25 und 50 kg Gewicht) an Schweinemästereien. Die in dänischem Besitz befindlichen Schlachthöfe haben mittlerweile eine Kapazität zur Verarbeitung von jährlich 1,5 Millionen Schweinen. Smithfield schuf mit dem Aufkauf und der Erweiterung vorhandener Schlachthöfe in diesem Land eine Jahreskapazität zur Verarbeitung von 3 Millionen Schweinen. Auch wenn damit noch kein landesweites Monopol erreicht ist – laut dem polnischen Amt für Statistik betrug im Jahr 2010 die landesweite Population knapp 15 Millionen Schweine – belegen die genannten Zahlen einen deutlichen Konzentrationsprozess, insbesondere angesichts der seit einiger Zeit rückläufigen Schweinebestände in den osteuropäischen Ländern.
Smithfield etablierte sich auch in Rumänien und gründete dort im Jahr 2004 eine Niederlassung, verbunden mit Plänen, im Laufe der Zeit eine jährliche Produktionskapazität von vier Millionen Schweinen zu installieren. Die geplante Errichtung von Mastfabriken in der Nähe der rumänischen Stadt Timisoara stieß auf den organisierten Widerstand der betroffenen Gemeinden.
Proteste im Osten
Litauen wurde 1998 „entdeckt“. Ein unter dem Namen Saerimner gegründetes dänisches Konsortium begann, die ehemaligen sowjetischen Mastfabriken aufzukaufen und wieder in Betrieb zu nehmen. Damit verbunden war das später nicht eingelöste Versprechen, die Anlagen umweltfreundlich zu gestalten. Die Dänen vertraten die Ansicht, dass es „ein Leichtes“ sein würde, in Litauen jährlich 10 Millionen Schweine zu mästen. Während die finanziell gebeutelten litauischen Lokalverwaltungen den geplanten Investitionen anfangs aufgeschlossen gegenüberstanden, wurden in der Bevölkerung Erinnerungen an die Gesundheits- und Umweltfolgen der Schweinemastindustrie zu sowjetischen Zeiten geweckt. Deshalb stand die Bevölkerung der betroffenen Dörfer den Projekten von Anbeginn ablehnend gegenüber. In einer wilden Mischung aus Ökoaktivismus und nationalistischen bis hin zu fremdenfeindlichen Ressentiments kam es über die Jahre zu einer breiten Mobilisierung, die durch mehrere Umweltskandale bei der Ausbringung der Schweinegülle zusätzlichen Schwung erhielt. Im Jahr 2008 wurden die dänischen Expansionspläne schließlich erheblich beschnitten. Der dänische „Schweinekönig“ Claus Baltersen, führende Figur im Saerimner-Konsortium, zeigte sich bitter enttäuscht und kündigte an, künftig in Lettland und der russischen Föderation zu investieren, wo es ein „geschäftsfreundlicheres“ Klima gäbe.
In Ostdeutschland sind vor allem holländische Investoren aktiv. Auch ihr Investitionsdrang wurde bislang nur teilweise befriedigt. Am bekanntesten dürfte der Agrarindustrielle Harrie van Gennip sein. Nach der im Jahr 1997 erfolgten Inbetriebnahme von Europas größter Mastfabrik (65000 Stallplätze) in Sandbeiendorf im nördlichen Sachen-Anhalt, bemüht er sich seit 2004 um den Standort Haßleben im nordöstlichen Brandenburg. Hier befand sich bis zum Zusammenbruch der DDR eine so genannte „Hunderttausender“ Schweinemastanlage. Für Haßleben beantragte der holländische Investor ursprünglich eine Anlage mit 85000 Stallplätzen. Dies scheiterte an den Einsprüchen einer Bürgerinitiative, die, ähnlich wie in Litauen, von Umweltorganisationen unterstützt wurde. Das Geschehen in Haßleben, bestehend aus zivilgesellschaftlichem Widerstand, der Erteilung von Auflagen sowie der Rücknahme und Wiederbeantragung von Betriebsgenehmigungen ist bis heute nicht abgeschlossen. Im dritten Anlauf genehmigte das Landesumweltamt Brandenburg im Juni 2013 trotz fortbestehender Einwände eine Anlage mit 37000 Stallplätzen. Ein kurz danach durch van Gennip gestellter Eilantrag auf sofortige Wirksamkeit der Genehmigung kam jedoch nicht durch. Anfang Dezember 2013 zog der Holländer den Eilantrag zurück. Ob damit das Ende des Investitionsvorhabens besiegelt ist, bleibt abzuwarten. An weiteren ostdeutschen Standorten sind die Versuche, Mastfabriken zu errichten, ebenfalls ins Stocken geraten oder ganz gescheitert. Im Jahr 2003 träumte van Gennip davon, in Mahlwinkel, sieben Kilometer von Sandbeiendorf entfernt, eine Schweinemastanlage mit ca. 80000 Tierplätzen zur errichten. Auch hier kam es zu Protesten und Einwänden durch eine Bürgerinitiative. Im vorigen Jahr wurde eine abgespeckte Variante beantragt, bei der es nunmehr um einen Zuchtbetrieb für 11000 Ferkel und 20000 Mastschweine geht. Aufgrund einer im April 2013 verabschiedeten Änderung des Paragraphen 35 des Baugesetzbuches sind die Gegner des Vorhabens jedoch optimistisch, dass das Vorhaben auch in seiner reduzierten Form zum Scheitern verurteilt ist. In Absatz 1, Nummer 4 dieses Paragraphen wird der Bau von Tierhaltungsanlagen außerhalb von Dörfern dahingehend privilegiert, dass dafür kein Bebauungsplan erforderlich ist. Mit dem seit 20. September 2013 geltenden Gesetz wird die Privilegierung im Fall von Schweinemastbetrieben jedoch auf Ställe mit maximal 3000 Plätzen beschränkt.
Die Gebrüder Adrianus und Jacobus Nooren, holländische Investoren, versuchten 2005, in Allstedt bei Querfurt (Sachsen-Anhalt) das Gelände eines ehemaligen Militärflughafens zu kaufen, um dort eine Mastanlage zu errichten. Nach Protesten und einer Ablehnung im Zuge der Raumordnungsprüfung, zogen sie ihren Antrag zurück und kauften stattdessen existierende Stallgebäude an anderen ostdeutschen Standorten.
Ein weiterer Holländer, der skandalumwitterte Adrian Straathof, sollte nicht unerwähnt bleiben. Nach Angaben der Website www.pigbusiness.nl betreibt er 23 Anlagen mit insgesamt 65000 Schweinen in den Niederlanden, Deutschland und Ungarn. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) forderte Ende vorigen Jahres von den zuständigen Behörden, Straathof die Gewerbegenehmigung zu entziehen. An allen Standorten der Straathof’schen Tierfabriken gäbe es massive Proteste wegen der permanenten Missachtung von bau-, umwelt- und tierschutzrelevanten Vorschriften. Am bekanntesten davon ist wohl der Betrieb in Alt-Tellin (Vorpommern) mit insgesamt 10500 Sauen-Plätzen, der im Juli 2012 in Betrieb ging. Dieser Komplex wird allerdings von der 30000er Sauen-Anlage in Binde bei Salzwedel (nördliches Sachsen-Anhalt), die ebenfalls zur Straathof Holding gehört, noch deutlich übertroffen.
Schweinische Konzentrationsprozesse
Eingangs war davon die Rede, dass der Konzentrationsprozess im Bereich der Schweinemast mit Hilfe von Niedrigpreisen vorangetrieben wird. In der Studie „System billiges Schweinefleisch“, die im vorigen Jahr vom Aktionsbündnis bäuerliche Landwirtschaft (AbL) e.V. heraus gegeben wurde, ist der preisgetriebene Konzentrationsprozesses dieser vertikal integrierten Branche detailliert beschrieben. Der Preisdruck wird mit unterschiedlichen Mitteln aufgefangen. Bereits verwiesen wurde hier auf Billiglöhne und die Externalisierung der mit den Mastfabriken verbundenen Umweltkosten im Zusammenhang mit der Wiederbesiedlung von Regionen, die zuvor auf die eine oder andere Weise ökonomisch zerstört wurden. Andere Faktoren, auf die hier nicht eingegangen werden konnte, sind der Import billiger Futtermittel (zur Subventionierung der Produktion siehe den Kasten zu Smithfield & Shuanghai international, Seite 17).
Neuer Konzentrationsschub
Konzentrationsprozesse haben natürlich vor allem Wachstum und immer größere Marktanteile als ultimative Ziele. Hier gibt es im Sektor Schweinefleisch ein Problem: Der europäische Markt ist im Großen und Ganzen gesättigt. Da bietet sich als Ausweg und Umweg an, diesen Konzentrationsprozess verstärkt durch Exporte in Schwellen- und Entwicklungsländer zu forcieren. So waren im Jahr 2000 Schweinefleischexporte aus Deutschland ins subsaharische Afrika mit 450 Tonnen faktisch inexistent. Im Jahr 2011 hingegen betrugen sie über 38000 Tonnen. Diese Form der – von der EU geförderten – Fleischexporte ist immer verbunden mit der Zerstörung landwirtschaftlicher und industrieller Strukturen in den betroffenen Regionen.
Inzwischen ist die Stunde der ganz Großen gekommen. Die wahren Riesen, Tönnies und KTG Agrar, schicken sich derzeit an, Produktionsstätten für eine Million Mastschweine in Russland zu errichten. Nach Einschätzung der AbL wurden diese Investitionen auch durch die EU-Flächensubventionen vorfinanziert. Tönnies besetzt mit rund 25 Prozent Marktanteil den ersten Platz in der deutschen Schlachtindustrie. Die KTG Gruppe ist nach eigener Darstellung mit 40000 Hektar Ackerland in Deutschland und Litauen „einer der führenden Agrarbetriebe in Europa“ und „deckt viele Stufen der Nahrungswertschöpfungskette ab“.
Im globalen Wettbewerb sind ruinöser Preiskampf und schweinische Konkurrenz noch nicht zu Ende. Im Jahr 2010 lagen die Erzeugerpreise für Schweinefleisch bei den EU-27-Staaten noch immer 38 Prozent über den kanadischen und 14 Prozent über denen der USA. Die osteuropäischen „Standortvorteile“ dürften bei den künftigen Konkurrenzkämpfen eine wichtige Rolle spielen.
Quellen:
Borzel, T.: Environmental Leaders and Laggards in Europe: Why There is (not) a Southern Problem.
Ashgate, Aldershot, 2003. zitiert in Juska, A. (2010): Profits to the Danes, for us – Hog stench? The campaign against Danish swine CAFOs in rural Lithuania. J. of Rural Studies 26 250–259.
Donham, K.J. (2010): Community and occupational health concerns in pork production: A review. J. of Animal Science 88: E102-E111.
Thomsen, B. (2013): System billiges Schweinefleisch. Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) e.V., Hamm, 48 S. http://www.abl-ev.de/fileadmin/Dokumente/AbL_ev/Welthandel/abl_fleischstudie_web.pdf
Erschienen in Heft 25 von Lunapark21. Hier der Text mit ergänzenden Informationen als PDF