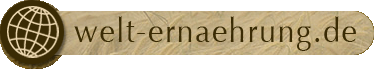Kein Wald vor lauter Bäumen (Beitrag zum „Tag des Waldes“ am 21.3.2016)
von Peter Clausing
Weltweit verlangsamt sich die Abholzung. Neu angepflanzt werden allerdings riesige Monokulturen, die etlichen Millionen Menschen keine Lebensgrundlage mehr bieten.
Inzwischen ist praktisch jeder Tag des Jahres ein Gedenk- oder Aktionstag. Die Liste bei Wikipedia ist entsprechend lang und bisweilen skurril. Wer würde schon vermuten, dass es einen »Tag der Blockflöte« und einen »Internationalen Tag des Eies« gibt? Der »Tag des Waldes«, der alljährlich am 21. März begangen wird, hingegen klingt seriös. Er wurde Ende der 1970er Jahre von der UN-Welternährungsorganisation (FAO) initiiert und hat ganz offensichtlich etwas mit Umwelt- und Naturschutz zu tun. Dieser Tag ist ein willkommener Anlass zu hinterfragen, wie die Waldschutzbemühungen heute aussehen, wer Nutzen daraus zieht und was das eigentlich ist – der Wald, der laut aktueller FAO-Statistik 30,6 Prozent der Landfläche der Erde bedeckt.
Bei der Definition des Begriffs »Wald« scheiden sich die Geister unter anderem an der Frage, ob Baumplantagen als Wälder gelten können. Die FAO zählt sie mit, und diejenigen, die Bäume in erster Linie als Rohstofflieferanten und CO2-Senken (also ein Reservoir, das zeitweilig oder dauerhaft Kohlenstoff speichert) betrachten, sehen das durchaus auch so. Diejenigen jedoch, die unmittelbar im oder vom Wald leben, sehen das völlig anders, denn für sie bieten Monokulturen aus einer einzigen Baumart – berüchtigt sind Eukalyptuswälder und Palmölplantagen – keine Lebensgrundlage. Aber auch Wälder, die im Rahmen des REDD+-Programms 1 zu Schutzgebieten erklärt wurden, um als CO2-Senken zu dienen, gehen oftmals für die ursprünglichen Bewohnerinnen und Bewohner verloren, wenn sie in diesen Wäldern nicht mehr leben bzw. diese nicht mehr betreten dürfen, um dort Früchte, Heilpflanzen und gegebenenfalls etwas Holz für ihren persönlichen Bedarf zu gewinnen. Nach Schätzungen der FAO sind heute rund 1,2 Milliarden Menschen ganz oder teilweise vom Wald abhängig, der »zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse und zur Verbesserung ihrer Lebensqualität« beiträgt.2 Viele Nichtregierungsorganisationen, allen voran das World Rainforest Movement (WRM), setzen sich genau für diese Menschen ein und unterstützen deren soziale Kämpfe, verbunden mit einer vehementen Kritik an Holzplantagen und Emissionshandel.
Trügerischer Trend
Die FAO ist vorsichtig optimistisch, dass sich die globale Entwaldung verlangsamt und das »Management« der Wälder verbessert hat. Das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Lage für viele Menschen vor Ort kaum entspannt und sich in manchen Regionen sogar verschlechtert. Als die FAO im September 2015 in Durban ihren globalen Waldbericht vorstellte 3, verwies sie darauf, dass sich die geschätzte Entwaldungsrate in den letzten zwei Jahrzehnten mehr als halbiert habe. In den frühen 1990er Jahren betrug sie 0,18 Prozent jährlich. Für die Zeit von 2010 bis 2015 wird sie auf durchschnittlich 0,08 Prozent pro Jahr beziffert. Seit 1990 verschwanden 1,3 Millionen Quadratkilometer Wald und das, obwohl auf 1,1 Millionen Quadratkilometern Bäume angepflanzt wurden. Doch Holzplantagen stellen kein für Menschen bewohnbares Habitat dar. Abgesehen von ihrer eingeschränkten biologischen Vielfalt werden die Eigentümer der Anpflanzungen – Anleger, die in das Holzgeschäft und in den Emissionshandel investieren – die traditionellen Nutzer kaum länger tolerieren. Zählt man die verlorengegangenen Waldflächen und die Anpflanzungen zusammen, sind es im Vergleich zu 1990 rund 2,4 Millionen Quadratkilometer weniger Wald, die den Menschen zum Leben zur Verfügung stehen. Das entspricht mehr als der Hälfte der Gesamtfläche der EU.
Wenige Wochen nach Vorlage des oben erwähnten globalen Waldberichts, in dem die verlangsamte Entwaldungsrate begrüßt wurde, freute sich die FAO über das Wiederaufleben des globalen Holzgeschäfts.4 Die Frage ist, wie sich diese beiden Entwicklungen miteinander vertragen. Wird der steigende Holzbedarf durch Plantagen mit schnellwachsenden Baumarten abgefangen oder werden die globalen Waldverluste wieder zunehmen? Könnte es sein, dass die Holzproduktion, die 2014 laut FAO das Vorkrisenniveau von 2007 überstieg, sich erst zeitlich verzögert in der Entwaldungsstatistik niederschlägt? Die Feststellung der FAO, dass das Wachstum der globalen Holzindustrie wichtig für das Wohlergehen von Millionen »waldabhängiger« Menschen sei, erscheint, gelinde gesagt, etwas einseitig. Laut FAO-Statistik sind rund zwölf Millionen Menschen auf dieser Erde in der Forstwirtschaft tätig. Es stimmt also, dass das Einkommen von Millionen Menschen vom Wald abhängig ist. Doch das ist nur ein Prozent der 1,2 Milliarden Menschen, die im und vom Wald leben. Wie vielen Menschen durch Holzeinschlag geschadet oder die Lebensgrundlage sogar gänzlich zerstört wird, darüber gibt es bei der FAO keine Statistik.
Länder, in denen die Waldfläche wieder wächst, leben nicht selten auf Kosten anderer Länder, aus denen sie Holz importieren. So hat China zwar ein umfangreiches Wiederaufforstungsprogramm, das nach Einschätzung der US-amerikanischen Forstwissenschaftlerin Alicia Robbins »eine der wenigen Erfolgsgeschichten im Umweltbereich« darstellt, aber das reicht bei weitem nicht für den Rohstoffhunger des Landes. Die Waldfläche Chinas liegt derzeit bei 22 Prozent (verglichen mit unter zehn Prozent Anfang der 1950er Jahre). Doch diese Bilanz wird durch massive Holzimporte, insbesondere aus Russland, Südostasien und Afrika aufrechterhalten. Das schließt – Berichten der in London ansässigen Environmental Investigation Agency zufolge – in beträchtlichem Umfang illegale Importe aus Indonesien, Laos, Mosambik und Myanmar mit ein. Illegale Machenschaften sind allerdings kein Alleinstellungsmerkmal chinesischer Konzerne. Das in Berlin ansässige European Center for Constitutional and Human Rights, das im April 2013 Strafanzeige gegen den deutsch-schweizerischen Holzkonzern Danzer Group erstattete, weist darauf hin, dass der Danzer-Fall typisch sei »für eine weitverbreitete Problematik in Afrika, Asien und Lateinamerika: Projekte oder Geschäfte transnationaler Unternehmen führen zu sozialen Konflikten, in die dann lokale Sicherheitskräfte mit oft extremer Gewalt eingreifen«.5 Bei diesem Fall, der in der bei solchen Fällen üblichen Manier inzwischen von der Tübinger Staatsanwaltschaft zu den Akten gelegt wurde, ging es um die Mitverantwortung für die Misshandlung und Vergewaltigung von Bewohnerinnen und Bewohnern eines Dorfes in der Demokratischen Republik Kongo. Die Danzer-Gruppe gehörte zu den wenigen Firmen, die schon zu Zeiten Mobutus, der das Land von 1971 bis 1997 diktatorisch regierte, im Kongo-Becken Einschlagskonzessionen für über 2,4 Millionen Hektar besaß.6 Auf die Demokratische Republik Kongo, deren Wälder mehr als das Doppelte der Fläche Frankreichs bedecken, trifft die Sorge um die Zerstörung von Lebensgrundlagen in besonderem Maße zu, denn 70 Prozent der Bevölkerung dieses Landes leben in oder an Wäldern.
Kombiniert man die Erkenntnisse zur Wiederbewaldung in bestimmten Ländern mit Daten vom internationalen Holzhandel, wird erkennbar, wer von dieser Entwicklung profitiert und auf wessen Kosten. Die belgischen Geographen Patrick Meyfroidt und Eric Lambin untersuchten sieben Länder, deren Waldfläche sich in den letzten 25 Jahren vergrößert hatte. Neben China analysierten sie so unterschiedliche Länder wie Bhutan, Chile, Costa Rica, El Salvador, Indien und Vietnam. Aus den Handelsbilanzen für land- und forstwirtschaftliche Produkte konnten die beiden Wissenschaftler ableiten, dass diese Länder zusammengenommen das Comeback ihrer Wälder zu 22 Prozent durch Importe ermöglichten. Zu den Staaten, die ihrerseits durch ruinöse Exporte zur Wiederbewaldung in anderen Regionen beitragen, gehören neben den oben genannten auch Brasilien, Indonesien und Kamerun, alles Länder, die für zahlreiche Landkonflikte zwischen exportorientierten Unternehmen und der jeweiligen lokalen Bevölkerung bekannt sind.
Marktliberale Lösungen
Ein besonders dynamisches Segment in diesem Geschäft sind Holzpellets. Sie haben zwar einen vergleichsweise geringen Anteil an der Handelsbilanz insgesamt, doch das Geschäft boomt. Im Jahr 2014 wurden global 26 Millionen Tonnen produziert – ein Anstieg um 35 Prozent innerhalb von zwei Jahren (die Datenbank der FAO führt die Position »Holzpellets« überhaupt erst seit 2012). In Asien verdoppelte sich der Verbrauch von 2013 zu 2014. Doch die absoluten Spitzenverbraucher sind bislang die waldarmen EU-Länder Großbritannien und Dänemark. Dort wird rund ein Viertel aller in der Welt erzeugten Holzpellets verbrannt, wobei 95 Prozent davon importiert werden. Deutschland schneidet in dieser Beziehung bescheiden ab. Hier wurden 2,1 Millionen Tonnen Pellets produziert, 0,4 Millionen Tonnen importiert und 0,7 Millionen Tonnen exportiert, woraus sich ein Verbrauch von 1,8 Millionen Tonnen ergibt* (zum Vergleich: Auch Dänemark mit nur 5,6 Millionen Einwohnern verbrauchte über zwei Millionen Tonnen). Ähnlich wie bei den Kohlenstoffsenken werden Holzpellets als Beitrag zu den Klimaschutzzielen angepriesen, denn sie kommen ja von nachwachsenden Rohstoffen und werden als nahezu klimaneutral betrachtet. Sie sind also ein weiterer Beitrag dazu, dass ein beträchtlicher Teil des vermeintlichen Klimaschutzes in den Industrieländern nicht in Form einer realen Reduzierung des Ausstoßes an klimaschädlichen Gasen verbucht wird, sondern durch umfangreiche Importe von »klimafreundlichen« Rohstoffen bzw. durch den virtuellen Export von Kohlendioxid. Während Agrotreibstoffe in aller Munde sind, hat das boomende Geschäft mit Holzpellets bislang kaum Beachtung gefunden. EU-Staaten wie Dänemark, Großbritannien und auch Italien hinterlassen damit einen beachtlichen »ökologischen Fußabdruck« im Ausland.
Das bedeutendste und am meisten umstrittene Unterfangen im Rahmen des Klimaschutzes ist jedoch das REDD+-Programm. Es stellt eine besonders problematische Erweiterung des ohnehin fragwürdigen Emissionshandels dar, der von den Protagonisten marktliberaler Lösungen trotz seines offensichtlichen Scheiterns weiterhin als effizientes Klimaschutzinstrument gepriesen wird. Die Grund¬idee ist sehr einfach: Regierungen, Unternehmen bzw. Waldeigentümer in den Ländern des Südens werden dafür belohnt, dass sie ihre Wälder stehenlassen, statt sie abzuholzen. Der Vorschlag wurde ursprünglich im Jahr 2005 von einer Gruppe aus 50 Ländern unterbreitet, die sich als »Koalition der Regenwaldnationen« bezeichnete. Zwei Jahre später wurde der Vorschlag auf dem Klimagipfel in Bali aufgegriffen und schließlich 2010 auf der 16. Weltklimakonferenz in Cancún verabschiedet. Nach Ansicht des kritischen Portals »REDD-Monitor« sitzt der Teufel bei dieser an und für sich guten Idee im Detail: »Das erste Detail besteht darin, dass nicht für den Erhalt von Wäldern gezahlt wird, sondern für die Reduktion von Emissionen, die sonst durch Abholzung und Waldzerstörung auftreten könnten. Das klingt wie Haarspalterei, ist aber wichtig, weil es zum Beispiel die Möglichkeit eröffnet, die Abholzung von Wäldern an anderer Stelle mit der Pflanzung industrieller Baumplantagen zu kompensieren.« 7 Was das für die lokale Bevölkerung bedeutet, wurde weiter oben bereits angesprochen.
Der REDD-Monitor weist darauf hin, dass die Idee von REDD nicht neu ist und in das 1997 in Kyoto verabschiedete Klimaschutzabkommen aufgrund von vier fundamentalen Mängeln keinen Eingang fand. Diese Mängel bestehen auch heute noch. Dazu gehört unter anderem ein als »Leakage« bezeichnetes Phänomen: Jemand, der aufgrund von Schutzmaßnahmen in einer Region keine Bäume mehr fällen darf, kann sein Geschäft einfach verlagern, so dass der Klimaschaden weiterhin eintritt, nur an anderer Stelle. Das zweite Problem betrifft die fehlende Dauerhaftigkeit des Effekts – in Bäumen gespeichertes Kohlendioxid ist dort nur für eine begrenzte Zeit fixiert und kehrt irgendwann in die Atmosphäre zurück. Ein drittes Problem ist die bis heute unbefriedigende Messbarkeit der tatsächlich gespeicherten CO2-Menge. Bei dem hochkomplexen System Wald, das den Waldboden mit einschließt, können die Schätzungen mit sehr großen Fehlern behaftet sein.
Es wäre also viel einfacher und sicherer, angemessene Prämien nur für das Nichtabholzen von Wald zu zahlen. Dies läuft jedoch der »Geschäfts¬idee« des privaten Handels mit Emissionszertifikaten zuwider, einer Idee, die einerseits die persönliche Bereicherung bestimmter Akteure ermöglicht und andererseits Industrieunternehmen das Schlupfloch bietet, statt teurer technischer Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes, billige Zertifikate zu kaufen. Selbst das Handelsblatt kam im Jahr 2010 zur der Auffassung: »Spekulanten, Energiekonzerne und Kriminelle bereichern sich hemmungslos an CO2-Zertifikaten«. Der Handel mit diesen Papieren wächst weiterhin an. Laut der NGO »Carbonmarketwatch« ist damit zu rechnen, dass sich in der EU bis 2020 etwa 1,3 Milliarden nicht genutzte Emissionsrechte angesammelt haben werden. Es spräche also vieles dafür, den Klima- und den Waldschutz nicht den Kräften des Marktes zu überlassen.
Über Leichen
Neben der zweifelhaften Wirksamkeit des REDD+-Programms bezüglich der Schutzziele häufen sich Klagen über Menschenrechtsverletzungen, die in diesem Zusammenhang immer öfter auftreten. Dabei gehen Missachtungen der sogenannten WSK-Rechte, also der von den Vereinten Nationen verbrieften wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, einher mit der Bedrohung, Inhaftierung, Ermordung von Aktivistinnen und Aktivisten. Die Ermordung von Berta Cáceres, der international bekannten Koordinatorin der honduranischen Indigenenorganisation COPINH, die kürzlich weltweit Empörung hervorgerufen hatte, ist ein herausragendes Beispiel dafür. Dabei scheint der Mord an ihr am 3. März der Auftakt zu einem Generalangriff gegen die Führungskräfte widerständiger zivilgesellschaftlicher Organisationen in Honduras gewesen zu sein. An einem einzigen Tag, am 15. März 2016, wurde ein weiteres Führungsmitglied von COPINH ermordet, erfolgte ein Mordversuch an der Koordinatorin von »La Via Campesina« und zwei Aktivisten wurden inhaftiert. Honduras wird seit dem Putsch von 2009 von einer ultrarechten Regierung beherrscht, erfreut sich aber dessen ungeachtet deutscher »Entwicklungs-« und Investitionshilfen.
Die Hälfte des Territoriums von Honduras ist mit Wald bedeckt, und das Land weist eine der höchsten Abholzungsraten auf – ein Paradebeispiel für REDD+, den Magdalena Heuwieser in ihrem Buch »Grüner Kolonialismus in Honduras« anschaulich darstellt.8 Heuwieser gibt die Sicht von COPINH wieder, derzufolge das REDD+-Programm eine Merkantilisierung der Wälder, der Natur und des Lebens bedeutet, da der Wald nur hinsichtlich seiner Kapazität der CO2-Aufnahme wertgeschätzt und verwertet wird. Die Indigenenorganisation setzt die REDD-Projekte den Bergbaukonzessionen gleich, die zur Einschränkung der wirtschaftlichen, ernährungsspezifischen, politischen, sozialen und kulturellen Souveränität indigener Bevölkerungsgruppen führen.
Auch wenn die weltweiten Kämpfe zivilgesellschaftlicher Initiativen und indigener Organisationen für Klimagerechtigkeit und den Erhalt der Umwelt zunehmen, ist es, wenn man die punktuellen Erfolge dazu ins Verhältnis setzt, doch ein Kampf von David gegen Goliath. Dass eine globale Rezession mehr zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes beiträgt als diverse halbherzige Klimaschutzmaßnahmen ist mittlerweile eine Binsenweisheit. Das gleiche trifft wahrscheinlich auf die Verminderung der Entwaldungsrate zu. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2007 war die globale Holzgewinnung in den Jahren 2008 und 2009 um 8,5 bzw. 16 Prozent reduziert. Das sind handfeste, wenngleich sehr schräge Beweise dafür, dass zur Bekämpfung von Waldverlust und Klimawandel das sogenannte Degrowth-Konzept am erfolgversprechendsten sein dürfte, also ein Konzept, das den Ressourcenverbrauch einfriert und schrittweise herunterfährt, statt ein Wachstum des Bruttosozialprodukts zur Voraussetzung für das Wohlergehen der Bevölkerung zu erklären. Das hat weder etwas mit globalen Rezessionen noch mit einer Verelendungstheorie zu tun, wohl aber mit einem konsequenten Abschied von falschen Anreizen und, bei einem Teil der Bevölkerung, übersteigerten Bedürfnissen. Wie das Beispiel Kuba zeigt, das Anfang der 1990er Jahre eine extreme und zugleich unfreiwillige Degrowth-Phase durchlebt hat, kann ein solcher Wandel nur in einem Klima gesellschaftlicher Solidarität gestaltet werden, also etwas, das nicht mit dem System zusammenpasst, in dem wir derzeit leben.
Das mit kapitalistischen Wirtschaftskrisen verbundene Ausbleiben von Wirtschaftswachstum trifft bekanntlich die ärmsten Schichten am härtesten und bietet den Mächtigen zugleich Möglichkeiten für eine weitere Umverteilung des Reichtums. Solche Entwicklungen stehen im scharfen Kontrast zu einer wahrhaft nachhaltigen Entwicklung, die Pamela Stricker in ihrem Buch über Kubas Umwelt- und Landwirtschaftspolitik als eine durch soziale Gerechtigkeit charakterisierte Entwicklung definierte, die zwei Aspekte kombiniert: die Deckung der menschlichen Grundbedürfnisse, verbunden mit der Schaffung der Voraussetzungen zur Entwicklung der persönlichen Fähigkeiten.9 Hingegen sind Lösungsversuche für die hier angesprochenen Umweltprobleme, die auf ressourcensparende Technologien setzen, dann zum Scheitern verurteilt, wenn dies entkoppelt von den notwendigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geschieht. Denn so werden es nur weitere Beispiele für Jevons’ Paradoxon sein. Der britische Ökonom William Stanley Jevons schilderte in seinem 1865 erschienenen Buch »The Coal Question« (Die Kohlefrage), dass trotz der Einführung von deutlich energieeffizienteren Dampfmaschinen, der Kohleverbrauch weiter anstieg, ein Phänomen, das für andere Versuche, nur durch technologische Neuerungen Ressourcen einzusparen, immer wieder beobachtet wurde. Mit den Waldverlusten in der heutigen Zeit könnte es ähnlich aussehen.
Anmerkungen
1 REDD steht für Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (Reduzierung der durch Abholzung und Zerstörung verursachten Emissionen ).
2 World deforestation slows down as more forests are better managed. Pressemitteilung der FAO vom 7.9.2015
3 FAO (2015): Global Forest Resources Assessment 2015. Desk Reference,
4 Resurgence in global wood production. Pressemitteilung der FAO vom 18.12.2015
5 ECCHR (2014) Fallbeschreibung Danzer
6 Klaus Pedersen: Naturschutz und Profit. Menschen zwischen Vertreibung und Naturzerstörung. Unrast-Verlag, Münster 2008
7 www.redd-monitor.org/redd-an-introduction
8 Magdalena Heuwieser: Grüner Kolonialismus in Honduras. Promedia-Verlag, Wien 2015
9 Pamela Stricker: Toward a Culture of Nature. Environmental Policy and Sustainable Development. Lexington Books 2007
*Werte nach dem Erscheinen in der „jungen Welt“ leicht korrigiert, mit Dank an Herrn Jens Dörschel vom Deutschen Pelletinstitut GmbH Berlin für die Hinweise
Erschienen in „junge Welt“ am am 22.3.2016