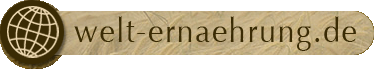Viel Macht für wenige
Unter dem Titel »Wer hat die Macht?« wurde anlässlich des G-7-Gipfels eine Studie des Fair Trade Advocacy Office Brüssel zu Machtkonzentration und unlauteren Handelspraktiken in diesen Wertschöpfungsketten vorgelegt. Von Peter Clausing Wenn sich am 7. und 8. Juni die Staats- und Regierungschefs der G-7-Länder auf Schloss Elmau in Oberbayern treffen, wird auch die Gestaltung von Handels- und Lieferketten ein Gesprächsthema sein. Diese Strukturen werden gern als Wertschöpfungsketten bezeichnet, was suggeriert, dass alle Beteiligten etwas abbekommen. Besonders jene Prozesse, die unsere Ernährung berühren, spielen eine wichtige Rolle. Doch die »Wertschöpfung« ist ungleich verteilt. Am einen Ende der Kette befinden sich 2,5 Milliarden Menschen, deren Einkommen von der Landwirtschaft abhängt. Ein Großteil von ihnen trägt dazu bei, dass die globalen Warenströme fließen, oder wird von diesen beeinflusst. Am anderen Ende: 3,5 Milliarden Menschen, die in Städten leben und folglich ihre Lebensmittel kaufen müssen. Dazwischen agieren diejenigen, die den überwiegenden Teil des (Mehr-)Wertes abschöpfen: die Händler, die Aktionäre der Agrar- und Lebensmittelindustrie und...
Lesezeit: 3 MinutenLöst Glyphosat Krebs aus? – Wichtige Lücke in Risikobewertung deutscher Behörde
Hamburg und München, 15.04.2015. Eine aktuelle Recherche des Pestizid Aktions-Netzwerks (PAN Germany) deckt eine wichtige Lücke bei der Risikobewertung von Glyphosat durch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) auf. Demnach gibt es derzeit mindestens zehn Studien, die zeigen, dass Glyphosat in Zellen sogenannten „oxidativen Stress“ auslöst, der auch zur Krebsentstehung führen kann. Diesen Wirkungsmechanismus hat das BfR jedoch außer Acht gelassen. Dieses Versäumnis könnte ein Grund dafür sein, dass das BfR, anders als ein internationales Gremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO), zu dem Schluss kommt, dass Glyphosat nicht krebserregend ist. Der Toxikologe Dr. Peter Clausing, der für das Pestizid Aktions-Netzwerk e. V. (PAN Germany) die vorliegenden Studien bewertet hatte, kritisiert: „Das BfR geht nur auf zwei Publikationen zum Thema oxidativer Stress ein, allerdings nicht im Zusammenhang mit einer möglichen Krebsentstehung. Mindestens acht weitere Untersuchungen aus den Jahren 2005 bis 2013, die über die Erzeugung von oxidativem Stress durch Glyphosat an Wirbeltieren wie Fischen, Kaulquappen, Mäusen und Ratten berichten, fanden überhaupt keine Erwähnung. Befunde...
Lesezeit: 2 MinutenDie lange Grüne Revolution
von Raj Patel In einer 63-seitigen Analyse, die Anfang 2013 erschien, beschäftigt sich der britische Soziologieprofessor Raj Patel faktenreich mit den Mythen der Grünen Revolution. Der nachstehende Text ist zugleich Auszug und Kondensat dieser umfangreichen Übersichtsarbeit. Historisch betrachtet erstreckte sich die Grüne Revolution über die Zeit von 1940 bis 1970, auch wenn die Prozesse der kapitalistischen Akkumulation, Enteignung, Investition und Innovation in der Landwirtschaft – die erst zwei Jahre vor ihrem offiziellen Ende „Grüne Revolution“ genannt wurden – bereits früher stattfanden und sich weit über 1970 fortsetzten. Die Väter der Grünen Revolution konnten ihre Ziele nicht beliebig durchsetzen, sondern mussten unter Nutzung staatlicher Mittel den oftmals kollektiv organisierten Widerstand der armen ländlichen Bevölkerung überwinden. Um die Grüne Revolution zu verstehen, sollte man sie als biopolitischen und geopolitischen Prozess verstehen, für den die Rockefeller-Stiftung zunächst Mexiko als Experimentierfeld auswählte. Das Ganze begann, als der US-Vizepräsident Henry Wallace, zugleich Gründer des heutigen Saatgutkonzern Pioneer Hi-Breed, im November 1940 an der Amtseinführung des...
Lesezeit: 6 MinutenDas Stickstoff-Dilemma
Von Peter Clausing Im Jahr 1910 ließen sich die BASF ein chemisches Verfahren zur Ammoniaksynthese aus Stickstoff und Wasserstoff patentieren. Das von den späteren Nobelpreisträgern Fritz Haber und Carl Bosch entwickelte Verfahren stellt laut Wikipedia das „bedeutendste industrielle Verfahren zur Umwandlung des unreaktiven Luftstickstoffs in eine nutzbare Stickstoffverbindung (dar)“. Dies ist ein energieintensiver Prozess, bei dem Temperaturen von 500 Grad Celsius erforderlich sind. Seine erste Konjunktur hatte das Haber-Bosch-Verfahren im Ersten Weltkrieg, als große Mengen von Ammoniak zur Herstellung von Munition und Sprengstoff benötigt wurden. Die Namensgeber des Verfahrens standen voll und ganz in deutsch-militaristischer Tradition. Fritz Haber gilt als „Vater des Gaskrieges“ im Ersten Weltkrieg und der jüngere Carl Bosch war während der Nazizeit „Wehrwirtschaftsführer“, also Spitzenfunktionär der NS-Kriegswirtschaft. Ähnlich wie zu anderen Anlässen – man denke an die Atomindustrie – wurden nach Kriegsende neue Absatzmärkten gesucht. Es begann die Ära des synthetischen Düngers. Heute wird der Mythos gepflegt, dass die Ernährung der Hälfte der Weltbevölkerung von diesem Dünger...
Lesezeit: 6 MinutenEnergieschleuder Agrarindustrie
von Peter Clausing In den letzten Jahrzehnten sind die Hektarerträge der industriellen Landwirtschaft erheblich gestiegen. Erkauft wurde dieser Zuwachs mit einem extrem hohen Einsatz fossiler Energieträger. Doch inzwischen ist die Euphorie über die Wunder der „grünen Revolution“ verflogen und es macht sich Ernüchterung breit. Trotz des fortgesetzten Einsatzes erdölbasierter Ressourcen stagnieren die Erträge oder sinken sogar. Eine wesentliche Ursache ist die nachlassende Bodenfruchtbarkeit aufgrund der vernachlässigten organischen Düngung und der Versalzung bewässerter Böden in semiariden Regionen. Mehr Aufwand als Ertrag Seit der Erdölkrise Mitte der 1970er-Jahre interessieren sich Wissenschaftler verstärkt für die Energiebilanzen landwirtschaftlicher Produktion. Fasst man die gewonnenen Erkenntnisse zusammen, wird schnell klar: Bei industriemäßiger Großflächenwirtschaft wird mehr (fossile) Energie verbraucht, als am Ende in der verzehrten Nahrung steckt (Pimentel, 1980). Außer jener Energie, die in der eigentlichen Produktion steckt, werden auch die für den Transport zu den Märkten und zur Herstellung von Verpackungsmaterial aufgewendete Energie und weitere Faktoren berücksichtigt. Daraus ergibt sich in der intensiven Landwirtschaft ein Aufwand...
Lesezeit: 5 MinutenOverkill auf dem Acker
Chemiekonzerne verticken in EU verbotene Pestizide noch immer massenhaft in Ländern des Südens. In Mexiko werden pro Hektar 16mal so viele Insektizide versprüht wie in Deutschland Von Peter Clausing Die »Grüne Revolution« wurde dereinst von der Rockefeller-Stiftung lanciert, um die »roten Revolutionen« zu bekämpfen, die in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg im globalen Süden aufflackerten. Ihre Väter schufen den Mythos, dass die Grüne Revolution viele Menschen vor dem Hungertod bewahrt hat. Tatsache ist, dass heute zwar genügend Nahrung für alle vorhanden ist. Trotzdem haben nach Angaben des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) noch immer 842 Millionen Menschen nicht genug zu essen. Alljährlich sterben 8,8 Millionen von ihnen an Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen, nach Angaben des ehemaligen UN-Sonderberichterstatters für das Recht auf Nahrung, Jean Ziegler, sogar mehr als doppelt so viele. Der Hungertod muß also andere Ursachen haben als ungenügende Hektarerträge. Ein unverzichtbarer Bestandteil der Grünen Revolution sind Pestizide. Während die Befürworter einer agrarindustriellen Intensivproduktion den Mythos der Rettung...
Lesezeit: 3 MinutenMexiko: Etappensieg gegen Konzerne
Mexiko: Zivilgericht stoppte Genmaisanbau. Agrarmultis laufen Sturm gegen das Urteil. Wissenschaftler starten internationale Kampagne zur Verhinderung von Agrogentechnik. Von Peter Clausing Seit Mitte der 1990er Jahre bemühen sich die Gentechnikkonzerne, in Mexiko Fuß zu fassen. Bei Baumwolle und Soja ist es ihnen bereits gelungen. Beim gentechnisch veränderten Mais schien Ende 2011 die letzte Hürde gefallen zu sein, aber inzwischen gibt es wieder Hoffnung. Der Mais hat in Mexiko sein Ursprungsgebiet. Mindestens 59 Sorten mit Tausenden Variationen sind bekannt. Neben den uns vertrauten gelben und weißen Kolben gibt es hier rote, blaue und schwarze. Selbst marmorierte, getüpfelte und mehrfarbige Körner sind zu finden. Deshalb und wegen der kulturellen Bedeutung von Mais, der in den Mythen der indigenen Bevölkerung eine zentrale Rolle spielt, gibt es seit vielen Jahren Widerstand gegen Genmais. Bis vor fünf Jahren galt ein striktes Moratorium, selbst für einen experimentellen Anbau. Dagegen liefen die transnationalen Agrarkonzerne Sturm. Das Moratorium höhlten sie schrittweise aus. Ein wichtiger Teilerfolg war für sie...
Lesezeit: 4 MinutenGastbeitrag: Die Metamorphose der Raubbaukonzerne
von Peter Gerhardt Es klingt ein bisschen wie im Märchen. Multinationale Konzerne zerstören Wälder und treten Menschenrechte mit Füßen. Durch das Engagement internationaler Umweltschutzorganisationen werden diese in wenigen Monaten dann zu verantwortungsvollen Unternehmen. Palmöl- und Papiermultis wie Wilmar, Golden Agri, APRIL (Asia Pacific Resources International Limited) oder APP (Asia Pulp and Paper) haben diese wundersame Metamorphose vom Kahlschlag-Konzern zum Regenwaldschützer in Indonesien bereits durchlaufen. All diese Firmen haben jetzt eine „Zero-Deforestation-Policy“. Parallel dazu haben Konsumgüterriesen wie Nestle, Unilever, Mars, L’Oreal, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive, die Palmöl als Rohstoff benötigen, ähnliche Versprechen abgegeben. Greenpeace WWF und Co. scheint zu gelingen, woran indonesische Umweltgruppen sich seit Jahren die Zähne ausbeißen: Notorische Regenwaldzerstörer zur Besserung zu bewegen. Die Drehbücher für diese Geschichten gleichen sich. Zunächst wird ein großer Konzern mit einer aufwändigen Kampagne in Nordamerika oder Europa an den Verhandlungstisch gezwungen. Dort wird zäh gerungen, aber fast immer kommt es zum Happy End: Der Konzern gelobt öffentlich Besserung und die an der...
Lesezeit: 4 MinutenIntensiv und ineffizient
Die industrielle Landwirtschaft ist an den Verbrauch fossiler Brennstoffe gekoppelt. Die Energiebilanz ihrer Produkte ist negativ. Von Peter Clausing Alljährlich am 17. April hat die globale Kleinbauernorganisation La Via-Campsina ihren Aktionstag. Die Organisation sagt, daß Kleinbauern energieeffizienter produzieren als Großbetriebe. Seit Jahrtausenden besteht der Sinn des Ackerbaus in der Umwandlung von Sonnenenergie in »essbare«. Das geschieht mit Hilfe der Photosynthese, deren Effizienz zwar gering ist, denn jener Anteil der eingestrahlten Sonnenenergie, der in Biomasse umgewandelt wird, beträgt weniger als zwei Prozent. Trotzdem wird über das Jahr und die Fläche verteilt in Früchten und Knollen genügend Energie akkumuliert, um die Weltbevölkerung zu versorgen. Die Sonnenstrahlung steht gratis zur Verfügung. Der Anteil an Energie, der darüber hinaus in die Erzeugung und Verarbeitung von Nahrung gesteckt wurde, war für lange Zeit von geringer Bedeutung. Diese Situation hat sich in den vergangenen hundert Jahren dramatisch geändert. Zwar wurden in den letzten Jahrzehnten in vielen Teilen der Welt die Hektarerträge erheblich gesteigert. Erkauft wurde dieser...
Lesezeit: 10 MinutenFünf Mal so viele Schweine wie Menschen
Industrielle Schweinemast in Mexiko: Granjas Caroll/Smithfield Von Peter Clausing Industrielle Schweinmastanlagen zerstören die Umwelt und rufen gesundheitliche Schäden hervor. Sie verunreinigen das Grundwasser sowie Oberflächengewässer und können Atembeschwerden, Nierenprobleme und andere Erkrankungen hervorrufen. Untersuchungen belegen die psychischen Wirkungen des permanenten Gestanks, den Mastfabriken erzeugen. All das bekommen auch die BewohnerInnen des Perote-Tals im mexikanischen Bundesstaat Veracruz zu spüren. Doch es bedurfte erst des Ausbruchs der vom H1N1-Virus hervorgerufenen Schweinegrippe im Jahr 2009, um die dortigen Verhältnisse ins Rampenlicht der internationalen Öffentlichkeit zu rücken. Der Ursprung dieser zeitweise von der Weltgesundheitsorganisation als globale Epidemie (Pandemie) eingestuften Grippewelle ließ sich in den Ort La Gloria zurückverfolgen, der sich in unmittelbarer Nähe zu einer der Mastfabriken des Unternehmens Granjas Carroll (GC) befindet. In Mexiko fand in den letzten Jahrzehnten ein wirtschaftlicher Konzentrationsprozess statt, in Folge dessen heutzutage 60 Prozent des Schweinefleischs in „technologisch fortgeschrittenen“ Betrieben produziert wird, was für den 150 Quadratkilometer großen Landkreis Perote (die Hälfte der Fläche von München) bedeutet, dass...
Lesezeit: 3 Minuten