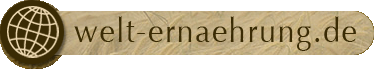Hunger und Verwüstung
Lebensmittelspekulation, Land Grabbing und Agrotreibstoffproduktion: Drei aktuelle Instrumente zur Renditemaximierung verursachen Nahrungsmangel und Verödung von Böden von Peter Clausing Die DWS Investments, eine Fondsgesellschaft der Deutschen Bank, frohlockte vor einiger Zeit auf ihrer Website: »Die rasant wachsende Weltbevölkerung, (…) Land- und Wasserknappheit – all das sind Punkte, die für überdurchschnittlich gute Perspektiven der Agrarwirtschaft sprechen.« Derlei Sprüche sind in der Welt der Investmentbanker inzwischen häufig zu finden. Die Fondsmanager bieten den Investoren sogenannte Alpha-Renditen von bis zu 25 Prozent jährlich. Die Angst vor »Brotrevolten« (Food Riots), die in den Jahren 2007/2008 die Welt erschütterten, scheint verflogen. Damals, als sich die Preise für Reis, Mais und andere Getreidearten innerhalb von ein, zwei Jahren verdoppelten oder gar verdreifachten, gab es Hungerproteste in über 40 Ländern.1 Im Jahr 2009 reduzierten sich die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel auf das Durchschnittsniveau von 2007, aber seit 2011 liegen sie sogar über dem Wert von 2008. Doch wo bleiben die Proteste? In etlichen Ländern, die vor knapp fünf...
Lesezeit: 9 MinutenGlobales Land Grabbing: die europäische Dimension
von Peter Clausing Die vier wesentlichen Triebkräfte, die den Kauf und die Pacht riesiger Flächen in den Ländern des Südens und Osteuropas befeuern – Nahrungsmittelspekulation, der Einsatz von Agrotreibstoffen, die Suche nach “sicheren“ Anlagen sowie Ernteausfälle aufgrund von Klimawandel und Bodenmüdigkeit – haben sich seit dem vor drei Jahren an dieser Stelle veröffentlichten Beitrag nicht geändert.(1) Allerdings haben sich bei den investierenden Interessengruppen die Proportionen verschoben: Waren es ursprünglich vor allem Länder mit prekärer Eigenversorgung, die auf der Suche nach mehr Unabhängigkeit von den Fluktuationen der Weltmarktpreise nach Möglichkeiten eines Offshore farming suchten, sind es heute in viel stärkerem Maße Investoren, die auf Steigerungen bei den Lebensmittel- und Bodenpreisen spekulieren. Hinzu kommt noch die Rolle der Europäischen Union und die der EU-„Bio“kraftstofflobby, wie im Folgenden gezeigt wird. Die Europäische Union und die „Bio“kraftstofflobby Bei Ländern mit prekärer Eigenversorgung denkt man zunächst an China, Südkorea und die Golfstaaten. Doch wenn es um Eigenversorgung durch importierte Waren geht, rückt Europa auf einen...
Lesezeit: 6 MinutenMalawi im Prisma der Welternährungskrise
von Peter Clausing Malawi, ein kleines Land im Herzen Afrikas, gehört mit seinen 14 Millionen Bewohnern zu den am dichtesten besiedelten Ländern Afrikas, nur übertroffen von Burundi, Gambia, Nigeria und Ruanda. Seine Ernährungsprobleme und die entsprechenden Lösungsversuche reflektieren eine ganze Reihe von Aspekten der globalen Ernährungskrise. Aufgrund des hohen Bevölkerungswachstums hat sich die Einwohnerzahl seit 1950 mehr als vervierfacht. Trotzdem liegt die Bevölkerungsdichte mit 120 Einwohner/km² noch immer deutlich unter der von Deutschland (229 Einwohner/km²). Malawi zählt zu den Least Developed Countries (LDC), einer sozialökonomischen Definition der UNO für die 48 ärmsten Länder der Welt. Trotz innenpolitischer Stabilität und obwohl das Land nicht vom „Ressourcenfluch“ heimgesucht ist, den der konservative Ökonom Paul Collier in fragwürdiger Weise als Wurzel allen Übels der Armut in Afrika betrachtet (1), hat das Land – seit langem ein Liebling der internationalen Entwicklungshilfe – es bis heute nicht geschafft, den LDC-Status zu verlassen. Schlimmer noch – in den letzten Jahrzehnten kam es wiederholt zu Hungersnöten, bei...
Lesezeit: 4 MinutenHunger – Katastrophe, Protest und Medienereignis
Wo liegen die Gründe für die skandalöse Diskrepanz zwischen Produktion und Versorgung? Von Peter Clausing Hunger ist die Alltagsrealität für ein Sechstel der Menschheit und – hungerbedingte Krankheiten mitberücksichtigt – die Todesursache für 10 Millionen Menschen jährlich. Spätestens seit der Explosion der Nahrungsmittelpreise 2007/2008 ist klar, dass das Milleniums-Entwicklungsziel, den Anteil der Menschen, die Hunger leiden, von 1990 bis 2015 zu halbieren, nicht annähernd erreicht werden wird. Statt zu einer Reduzierung kam es 2008 zu einem Anstieg der Zahl der Hungernden. Dabei wird Jahr für Jahr genügend produziert, um – statistisch betrachtet – alle Menschen mit ausreichend Nahrung zu versorgen.
Marktfrauen in Zomba, Malawi
Mexiko: Recht auf Nahrung – ein weiteres Lippenbekenntnis?
Katastrophale Auswirkungen der Freihandelsabkommen auf die Ernährungssituation in Mexiko Von Peter Clausing Mitte Oktober begrüßte Olivier de Schutter, UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, die Bekanntmachung Mexikos, eben diesem Recht Verfassungsrang einzuräumen. Bereits am Ende seiner im Juni durchgeführten Mexiko-Mission mahnte der UNO-Beauftragte mit Blick auf die anstehende Verfassungsreform „die weitere Verbesserung des juristischen Umfelds in Form einer Rahmengesetzgebung für das Recht auf Nahrung an, so, wie es in einer Reihe anderer Länder dieser Region bereits erfolgt ist“. Vor dem Hintergrund gravierender Missstände in den Bereichen Ernährung und landwirtschaftliche Produktion empfahl de Schutter eine nationale Strategie, um dem Recht auf Nahrung Geltung zu verschaffen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die verfassungsmäßige Anerkennung des Rechts auf Nahrung nicht nur eine weitere Inszenierung im Kontext von Mexikos simulierter Demokratie darstellt. Schließlich hat Mexiko die Anti-Folterkonvention der UNO im Januar 1986 ratifiziert und akzeptiert bis heute unter Folter erzwungene Geständnisse als Beweismittel vor seinen Gerichten. Auch das landläufig als ILO-Konvention 169...
Lesezeit: 5 MinutenPeak Soil II – Bodenzerstörung
Deutliches Gefahrenpotential Hintergrund. »Peak Soil« – Bodenzerstörung, Landraub und Ernährungskrise. Teil II: Der Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen und wie er abgewendet werden kann Peter Clausing Peak Soil – die unterschätzte Krise des Bodens« lautet der Titel eines im Vorjahr erschienenen Hefts der Zeitschrift Politische Ökologie. »Der Boden ist das vergessene Medium der Umweltpolitik. Erst viel zu spät und dann auch nicht vollständig hat das Umweltrecht auf die Schäden an den Böden reagiert«, stellt Günther Bachmann dort für die Situation in Deutschland fest.1 Winfried E. H. Blum, Professor für Bodenkunde an der Universität Wien, ergänzt: »Was sich derzeit in den Böden Europas abspielt, gilt im wesentlichen auch und zum Teil in noch stärkerem Maße für weitere Länder der Nordhalbkugel, vor allem aber für Afrika, Südamerika und Südostasien, wo Erosion, Verdichtung, Verlust an organischer Substanz sowie Biodiversität, Kontamination, Versalzung und insbesondere Erdrutsche ein alarmierendes Ausmaß erreicht haben.«2 Nach seiner Einschätzung wird die Intensivierung des vollmechanisierten Ackerbaus die Bodenprobleme noch weiter verschärfen. Boden und...
Lesezeit: 10 MinutenPeak Soil I – Hunger nach Land
Hintergrund »Peak Soil« – Bodenzerstörung, Landraub und Ernährungskrise. Teil I: Wie Konzerne und Spekulanten von der Verknappung von Lebensmitteln profitieren Peter Clausing »Peak Soil«1 lautet der Titel des 2009 erschienenen Buches des Berliner Autors Thomas Fritz, einer ersten umfassenderen Übersicht zum Thema »Land Grabbing« (Landnahme) in deutscher Sprache. Der Begriff »Land Grabbing« bezieht sich auf den Kauf bzw. die langfristige Pachtung großer Landflächen – vor allem in den Ländern des Südens, aber auch in Osteuropa – mit oft drastischen Auswirkungen auf die Lebenswirklichkeit der Bevölkerung. Die Ansichten, ab wann von »großen Landflächen« zu sprechen ist, divergieren. Während Olivier de Schutter, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung, 1000 Hektar als Untergrenze betrachtet, definierte die Nichtregierungsorganisation (NGO) GRAIN 10000 Hektar als unteres Limit. Entsprechend der Bedeutung dieses bedrohlichen Phänomens ist inzwischen eine Reihe von Publikationen erschienen, und es fanden zahlreiche nationale und internationale Tagungen zum Thema statt. »Land Grabbing, so scheint es, kommt wie ein Tsunami über die Welt,...
Lesezeit: 10 MinutenSchönredner bei der FAO
Aus: land & wirtschaft, junge Welt-Beilage vom 04.08.2010 von Peter Clausing Landnahme durch private Investoren in Afrika und Lateinamerika erreicht dramatische Dimensionen. UN-Ernährungsorganisation, Weltbank und Entwicklungspolitiker betonen »Chancen« »Man muß kein Bauer sein, um mit Ackerland Geld zu verdienen«, hieß es in einem Beitrag der Wochenzeitung Die Zeit vom 11. Februar 2010, der sich mit einem Trend beschäftigte, über den in den letzten zwei Jahren viel geschrieben und diskutiert wurde, ohne daß es seither zu einer Trendwende gekommen ist. Die Rede ist von der rasanten Aneignung des Produktionsmittels Boden durch Investoren und – seit der Preisexplosion im Nahrungsmittelbereich 2008 – durch finanzstarke Länder mit prekärer Eigenversorgung, international unter dem Begriff Land Grabbing bekannt. Die Berichterstattung in den Medien vermittelt den Eindruck, daß es vor allem die Regierungen Chinas, Südkoreas und der Golfstaaten seien, die diese Landumverteilung vorantreiben. Eine repräsentative Analyse des Londoner International Institute for Environment and Development (IIED) zeigte aber am Beispiel von Äthiopien, Ghana, Madagaskar und Mali, daß...
Lesezeit: 4 MinutenPräsentation zu Vortrag „Landgrabbing“ am 25.02.2010 in Berlin
Hier die Präsentation als Live-View (Flash) | PDF zum Vortrag „Turbo-Kapitalismus – die neue Landnahme im globalen Süden“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Frisch serviert vom Krisenherd“ (siehe Meldung vom 14.02.2010). Den Vortrag gab’s am 25.2.2010 um 19:00 Uhr in der »Galerie Zeitzone«, Adalbertstr. 79, 10997 Berlin-Kreuzberg.
Lesezeit: < 1 MinuteKommentiert: The Coming Food Coups by Natsios & Doley
In ihrem Beitrag „The Coming Food Coups“, der im Januar 2009 im Washington Quartely erschien, das vom Center for Strategic and International Studies herausgegeben wird, befassen sich Natsios und Doley mit den humanitären, politischen und Sicherheitskonsequenzen der Preisexplosionen bei Nahrungsmitteln. Dabei ist für sie die Famine Theory ein hilfreiches Werkzeug, also die Theorie von den Hungersnöten, „a body of knowledge about the microeconomic dynamics of famines, the vulnerability of people to food price shocks, and the common patterns of behavior people use to try to survive in different stages of a famine„. Ihrer Meinung nach müssen Politiker ausgerüstet sein, um die Sicherheits- (und andere) Konsequenzen derartiger Entwicklungen zu minimieren. Dabei betrachten sie – im Gegensatz zu Paul Collier (vgl. Medien-Offensive des Agrobusiness [1]) – die Rücknahme von Subventionen (z.B. für Agrotreibstoffe) in einer bürgerlichen Demokratie als unrealistisch. »The likelihood of a substantial reduction in U.S. corn-based ethanol subsidies is unlikely. Once democratic governments begin to subsidize something, withdrawing the subsidy...
Lesezeit: 3 Minuten