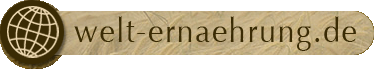Die lange Grüne Revolution
von Raj Patel In einer 63-seitigen Analyse, die Anfang 2013 erschien, beschäftigt sich der britische Soziologieprofessor Raj Patel faktenreich mit den Mythen der Grünen Revolution. Der nachstehende Text ist zugleich Auszug und Kondensat dieser umfangreichen Übersichtsarbeit. Historisch betrachtet erstreckte sich die Grüne Revolution über die Zeit von 1940 bis 1970, auch wenn die Prozesse der kapitalistischen Akkumulation, Enteignung, Investition und Innovation in der Landwirtschaft – die erst zwei Jahre vor ihrem offiziellen Ende „Grüne Revolution“ genannt wurden – bereits früher stattfanden und sich weit über 1970 fortsetzten. Die Väter der Grünen Revolution konnten ihre Ziele nicht beliebig durchsetzen, sondern mussten unter Nutzung staatlicher Mittel den oftmals kollektiv organisierten Widerstand der armen ländlichen Bevölkerung überwinden. Um die Grüne Revolution zu verstehen, sollte man sie als biopolitischen und geopolitischen Prozess verstehen, für den die Rockefeller-Stiftung zunächst Mexiko als Experimentierfeld auswählte. Das Ganze begann, als der US-Vizepräsident Henry Wallace, zugleich Gründer des heutigen Saatgutkonzern Pioneer Hi-Breed, im November 1940 an der Amtseinführung des...
Lesezeit: 6 MinutenEin diskursives Hungergespenst
von Peter Clausing Nicht selten ruft die Frage, ob und unter welchen Bedingungen die wachsende Weltbevölkerung ausreichend ernährt werden kann, Ratlosigkeit und Unbehagen hervor. Eine negative Antwort würde den Hungertod Hunderter Millionen Menschen mit kaum vorstellbaren gesellschaftlichen Folgen bedeuten. Schließlich sind schon heute zirka 850 Millionen Menschen unterernährt, was bedeutet, dass alljährlich etwa 10 Millionen Menschen an Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen sterben. Die Frage, was getan werden müsste, um bei gleichzeitig wachsender Weltbevölkerung von diesem Genozid wegzukommen, wird sehr unterschiedlich beantwortet. Zunächst ist festzuhalten, dass ein allgemeiner Konsens darüber besteht, dass die Weltbevölkerung nach 2050 nur noch unwesentlich zunehmen wird. Zwar werden in 35 Jahren voraussichtlich zwei Milliarden (30 Prozent) mehr Menschen auf der Erde leben als heute, jedoch bei stetig abnehmendem Bevölkerungswachstum. Nun vertreten Weltbank und Welternährungsorganisation (FAO) die Ansicht, dass dann, wenn 30 Prozent mehr Menschen die Welt bevölkern, 70 Prozent mehr Nahrungsmitteln zur Verfügung stehen müssten. Die Diskrepanz zwischen den 70 und 30 Prozent wird mit...
Lesezeit: 3 MinutenDas Stickstoff-Dilemma
Von Peter Clausing Im Jahr 1910 ließen sich die BASF ein chemisches Verfahren zur Ammoniaksynthese aus Stickstoff und Wasserstoff patentieren. Das von den späteren Nobelpreisträgern Fritz Haber und Carl Bosch entwickelte Verfahren stellt laut Wikipedia das „bedeutendste industrielle Verfahren zur Umwandlung des unreaktiven Luftstickstoffs in eine nutzbare Stickstoffverbindung (dar)“. Dies ist ein energieintensiver Prozess, bei dem Temperaturen von 500 Grad Celsius erforderlich sind. Seine erste Konjunktur hatte das Haber-Bosch-Verfahren im Ersten Weltkrieg, als große Mengen von Ammoniak zur Herstellung von Munition und Sprengstoff benötigt wurden. Die Namensgeber des Verfahrens standen voll und ganz in deutsch-militaristischer Tradition. Fritz Haber gilt als „Vater des Gaskrieges“ im Ersten Weltkrieg und der jüngere Carl Bosch war während der Nazizeit „Wehrwirtschaftsführer“, also Spitzenfunktionär der NS-Kriegswirtschaft. Ähnlich wie zu anderen Anlässen – man denke an die Atomindustrie – wurden nach Kriegsende neue Absatzmärkten gesucht. Es begann die Ära des synthetischen Düngers. Heute wird der Mythos gepflegt, dass die Ernährung der Hälfte der Weltbevölkerung von diesem Dünger...
Lesezeit: 6 MinutenEnergieschleuder Agrarindustrie
von Peter Clausing In den letzten Jahrzehnten sind die Hektarerträge der industriellen Landwirtschaft erheblich gestiegen. Erkauft wurde dieser Zuwachs mit einem extrem hohen Einsatz fossiler Energieträger. Doch inzwischen ist die Euphorie über die Wunder der „grünen Revolution“ verflogen und es macht sich Ernüchterung breit. Trotz des fortgesetzten Einsatzes erdölbasierter Ressourcen stagnieren die Erträge oder sinken sogar. Eine wesentliche Ursache ist die nachlassende Bodenfruchtbarkeit aufgrund der vernachlässigten organischen Düngung und der Versalzung bewässerter Böden in semiariden Regionen. Mehr Aufwand als Ertrag Seit der Erdölkrise Mitte der 1970er-Jahre interessieren sich Wissenschaftler verstärkt für die Energiebilanzen landwirtschaftlicher Produktion. Fasst man die gewonnenen Erkenntnisse zusammen, wird schnell klar: Bei industriemäßiger Großflächenwirtschaft wird mehr (fossile) Energie verbraucht, als am Ende in der verzehrten Nahrung steckt (Pimentel, 1980). Außer jener Energie, die in der eigentlichen Produktion steckt, werden auch die für den Transport zu den Märkten und zur Herstellung von Verpackungsmaterial aufgewendete Energie und weitere Faktoren berücksichtigt. Daraus ergibt sich in der intensiven Landwirtschaft ein Aufwand...
Lesezeit: 5 MinutenSanamadougou und Sahou müssen bleiben: Landraub stoppen – in Mali und überall sonst!
August 2014: Internationaler Appell der europäischen Sektion von Afrique-Europe-Interact [*] Anfang 2013 ist Mali kurzzeitig in die internationalen Schlagzeilen geraten. Islamistische Milizen hatten den Norden des Landes besetzt, es folgte eine internationale Militärintervention unter Führung Frankreichs, in deren Verlauf zumindest größere Städte wie Timbuktu und Gao befreit werden konnten. Und doch hat sich das Leben für die Masse der Bevölkerung kaum verändert – weder im Norden noch in den übrigen Landesteilen. Besonders dramatisch ist die soziale Lage von Kleinbauern und -bäuerinnen, die ungefähr 75 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Stellvertretend dafür stehen die beiden Dörfer Sanamadougou und Sahou 270 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bamako. Noch im Jahr 2009 haben diese zur Linderung einer landesweiten Ernährungskrise 40 Tonnen Hirse an die malische Regierung gespendet, heute sind sie selber auf Lebensmittellieferungen angewiesen. Denn im Zuge des weltweit boomenden Ausverkaufs fruchtbarer Acker-, Wald- und Weideflächen an Investmentfonds, Banken und Konzerne ist es auch in Sanamadougou und Sahou zu gewaltsamen Vertreibungen gekommen. Zudem mussten die...
Lesezeit: 5 MinutenGastbeitrag: Die Metamorphose der Raubbaukonzerne
von Peter Gerhardt Es klingt ein bisschen wie im Märchen. Multinationale Konzerne zerstören Wälder und treten Menschenrechte mit Füßen. Durch das Engagement internationaler Umweltschutzorganisationen werden diese in wenigen Monaten dann zu verantwortungsvollen Unternehmen. Palmöl- und Papiermultis wie Wilmar, Golden Agri, APRIL (Asia Pacific Resources International Limited) oder APP (Asia Pulp and Paper) haben diese wundersame Metamorphose vom Kahlschlag-Konzern zum Regenwaldschützer in Indonesien bereits durchlaufen. All diese Firmen haben jetzt eine „Zero-Deforestation-Policy“. Parallel dazu haben Konsumgüterriesen wie Nestle, Unilever, Mars, L’Oreal, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive, die Palmöl als Rohstoff benötigen, ähnliche Versprechen abgegeben. Greenpeace WWF und Co. scheint zu gelingen, woran indonesische Umweltgruppen sich seit Jahren die Zähne ausbeißen: Notorische Regenwaldzerstörer zur Besserung zu bewegen. Die Drehbücher für diese Geschichten gleichen sich. Zunächst wird ein großer Konzern mit einer aufwändigen Kampagne in Nordamerika oder Europa an den Verhandlungstisch gezwungen. Dort wird zäh gerungen, aber fast immer kommt es zum Happy End: Der Konzern gelobt öffentlich Besserung und die an der...
Lesezeit: 4 MinutenRezension: „Die Grüne Matrix“
Ein kurzer Werbeblock in eigener Sache (siehe Buchhinweis). Nachdem das Buch inzwischen mehrfach besprochen wurde (u.a. in „analyse + kritik“, in der taz, in der jW, in der „Unabhängigen Bauernstimme“, in den „Local Land & soil News“ und in der ILA) hier die Rezension von Isabel Armbrust aus dem WIDERSPRUCH (Nr. 64, März 2014) . Die Explosion der Agrarpreise 2008 löste einen beispiellosen Run auf die verfügbaren Anbauflächen dieser Welt aus. Mit Grosskäufen oder langlaufenden Pachtverträgen sichern sich seitdem Unternehmen und Staaten die Grundlage für lukrative Geschäfte oder die künftige Ernährung ihrer eigenen Bevölkerung. Auf der Strecke bleiben Kleinbauern und andere lokale Produzenten, die oft nicht einmal über Besitztitel für seit Generationen genutztes Land verfügen. Kaum ein anderes Thema ist in den vergangenen 5 Jahren in der entwicklungspolitischen Szene so intensiv diskutiert worden wie dieses Landgrabbing. Und doch greift aus Sicht des Autors von „Die grüne Matrix“ die Debatte zu kurz: Sie spart das Thema der Vertreibung von Menschen zur...
Lesezeit: 3 MinutenSchwein gehabt – Profit gemacht. Mastfabriken zwischen Profitzwang und Protesten
von Peter Clausing Lunapark21 Nr. 25; März 2014 Man nennt sie heute im angelsächsischen Fachjargon CAFOs – Concentrated Animal Feeding Operations. Eher banal und etwas direkter: Es geht um Mastfabriken. Und damit um riesige, global aktive Fleischkonzerne, von denen 2013 oder 2014 erstmals einer, der chinesische Riese Shuanghui International Holding, der 2013 den US-Fleischriesen Smithfield übernahm, zur Gruppe der 500 größten Konzerne der Welt, der „Global 500“, vorstoßen dürfte. CAFOS nutzen, ähnlich wie andere Industriezweige, billige Arbeitskräfte und niedrige bzw. nicht durchgesetzte Umweltstandards, um mit Niedrigpreisen im herrschenden Konkurrenzkampf bis zum Erreichen einer Monopolstellung profitabel zu bleiben. Das führt dazu, dass Mastfabriken bevorzugt in Regionen errichtet werden, wo zuvor die lokale Ökonomie zerstört wurde: Dort sind die Arbeitskräfte eher bereit, zu niedrigen Löhnen zu arbeiten; die zuständigen Behörden drücken im Bemühen, Investoren anzulocken, bei den Umweltauflagen gern mal ein Auge zu. Oder das betreffende Land verfügt erst gar nicht über halbwegs angemessene Regularien. Innerhalb der Europäischen Union existieren zwar diverse...
Lesezeit: 9 MinutenPräsentation zum Workshop in Hannover am 8.3.2014
Im Rahmen der eintägigen Veranstaltung „SCHON MAL ABSCHALTEN!?“ in Hannover fand ein Workshop zum Thema „Agrarindustrie“ statt. Der Workshop widmete sich den Klimabilanzen industrieller Landwirtschaft im Vergleich zu kleinbäuerlicher Landwirtschaft mit agrarökologischen Anbauverfahren. Diese Bilanzen wurden im Kontext der Sicherung der Ernährung einer im Vergleich zu heute um 30 Prozent größeren Weltbevölkerung im Jahr 2050 diskutiert. Die Präsentation zum Workshop findet sich hier.
Lesezeit: < 1 MinuteMonopol und Elend (Gastbeitrag)
Die weltweite Vereinheitlichung von Saatgut dient den Interessen der Agrarkonzerne und führt zur Entrechtung und Enteignung kleiner Landwirte Von Anne Schweigler Im August 2013 streikten die Bauern in Kolumbien für mehrere Wochen und stellten die Belieferung der Städte mit Nahrungsmitteln quasi ein. Zusammen mit Studenten, Indigenen und Industriearbeitern, die sich solidarisch erklärten, legten sie das Land lahm. Die Auswirkungen der Freihandelsabkommen mit den USA und Europa auf die Landwirtschaft des Landes und die Empörung über eine damit zusammenhängende Saatgutverordnung waren der zentrale Auslöser. Mit letzterer wurde selbstproduziertes Saatgut für illegal erklärt und dessen Beschlagnahmung und Zerstörung verfügt. Kolumbien ist ein Beispiel dafür, wie Saatgut weltweit Schritt für Schritt privatisiert und monopolisiert wird. Dahinter stehen die Interessen der Agrarkonzerne, deren Ziel es ist, nicht nur »ihre« industriellen Sorten mit Hilfe von Rechten an geistigem Eigentum zu kontrollieren, sondern gleichzeitig auch die Alternativen, das heißt freie Sorten, verbieten zu lassen. Dies erfolgt, indem die jahrtausendealte Praxis, einen Teil der Ernte aufzubewahren und...
Lesezeit: 10 Minuten