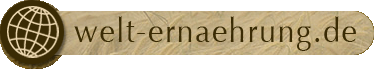Tagungsankündigung: Deutsche Unternehmen im Globalen Süden – Umwelt- und Menschenrechtsvergehen
Rüstungsexporte – Automobilindustrie – Pestizidexporte Tagung und Vernetzungstreffen Fr. 13. Januar 2017: 14:00 – 18:30 Sa. 14. Januar 2017: 10:00 – 16:15 Die Tagung soll Aktivist_innen, Wissenschaftler_innen, interessierten Personen, Student_innen einerseits einen Überblick zu bestimmten Aspekten dieses Rahmenthemas bieten und andererseits die Möglichkeit zur Vernetzung geben. Auf der Konferenz sollen die Bereiche Rüstungsexporte, Pestizidexporte und die Strategien der Autoindustrie unter folgender Fragestellung untersucht werden: Welche Rolle spielen deutsche Firmen und deutsche Exporte im globalen Süden? Ein Fokus wird dabei auf Menschenrechtsverletzungen durch deutsche Unternehmen in Mexiko liegen, jedoch werden auch weitere Länder des globalen Südens wie die Philippinen, Indien, Argentinien und Brasilien einbezogen. Aktivist_innen, Expert_innen und Interessierte sollen ihr „natürliches Umfeld“ verlassen und im Dialog neue Fragen aufwerfen, sich über ihre verschiedenen Aktionsformen sowie Falluntersuchungen austauschen. Dadurch soll ein wenig Licht in das Dunkel geworfen werden, in dem deutsche Unternehmen im globalen Süden operieren. Anmeldungen unter: thorsten.schulz@fdcl.org Das Programm hier zum Download
Lesezeit: < 1 MinutePhosphor: Fluch und Segen eines Elements
von Peter Clausing Der europäische Phosphorzyklus könnte vollständig geschlossen werden, wenn die importierten chemischen Phosphatdünger komplett gegen biologische und recyclte chemische Phosphordünger ersetzt würden. Damit stiege die Wasserqualität in Europa und viele andere Probleme wären gelöst. Doch um das zu erreichen, müsste das Diktat der »Marktkräfte« überwunden werden. Phosphor ist ein lebensnotwendiges chemisches Element. Sowohl im menschlichen Körper als auch in Pflanzen beträgt sein Anteil zwar nur zirka ein Prozent. Ohne Phosphor gäbe es aber kein Leben in seiner jetzigen Form. Er ist Baustein der Erbinformation DNS, von Proteinen und Enzymen. Die Freisetzung und Speicherung von Energie in den Zellen von Tieren und Pflanzen erfolgt unter obligatorischer Beteiligung von Phosphor. Im Pflanzenbau ist Phosphor unverzichtbar und kann durch nichts ersetzt werden. Daraus folgt, dass eine Landwirtschaft, die nicht auf geschlossenen Kreisläufen basiert, letztlich auf Phosphorzufuhr von außen angewiesen ist. Nach Verarbeitung des Rohphosphats wird der Phosphor in pflanzenverfügbarer Form in den Boden eingebracht, zumeist als Diphosphat, das wenig wasserlöslich ist,...
Lesezeit: 9 Minuten„Sauerei!“ – Bauer Willis misslungene Demagogie (Rezension)
von Peter Clausing „Sauerei!“ hätte ein gutes Buch werden können. Es ist flüssig geschrieben, wenngleich etwas distanzlos-kumpelhaft, aber das trifft sicher den Nerv vieler Leserinnen und Leser. Und der Verfasser ist ein echter Insider. Kremer-Schillings bewirtschaftet 50 Hektar, den gleichen Hof wie sein Vater und sein Großvater. Er schöpft aus dem Vollen, was die Beschreibung des Lebens eines Landwirts anbetrifft – und das über drei Generationen. Aber „Sauerei“ ist im besten Fall ein ärgerliches Buch, eher aber ein gefährliches, wenn man dem Aphorismus von Georg Christoph Lichtenberg folgt, der schon im 18. Jahrhundert erkannte: „Das Gefährliche sind nicht die dicken Lügen, sondern Wahrheiten, mäßig entstellt.“ Das Buch charakterisiert detailreich die Krise der deutschen und europäischen Landwirtschaft, um dann den Popanz des „Verbrauchers“ aufzubauen, der an der Misere des Landwirts schuld sei und in dessen Macht es läge, daran etwas zu ändern. Das soll uns nicht von verantwortungsvollem Verbrauch freisprechen. Doch damit allein wird das Problem nicht gelöst. Es ist nicht...
Lesezeit: 3 MinutenDie Glyphosat-Kampagne: Workshop am 22./23.8.2016
Hinweis in „eigener Sache“: Workshop auf dem Klimacamp Kampagnen und „System Change“. Überlegungen mit Rückblick auf die Glyphosat-Kampagne 2015/2016 Workshopleitung: Leonie Sontheimer (Kampagne „Ackergifte? Nein Danke!“ und Peter Clausing (PAN Germany) Im April 2015 wurde die Wiedergenehmigung des Pestizids Glyphosat erneut öffentlich diskutiert – und damit die Argumente, die dagegen sprechen. Was mit vereinzelten Pressemitteilungen begann, ist innerhalb eines Jahres zu Hunderttausenden von Unterschriften und gemeinsamen Appellen von zig Organisationen aus zahlreichen europäischen Ländern gewachsen. In dem Workshop sollen rückblickend die Rahmenbedingungen einer erfolgreich verlaufenen Kampagne analysiert werden. Zugleich steht im Raum, dass eine erfolgreiche Kampagne noch keinen Systemwandel bedeutet. Basierend auf dieser Erkenntnis soll gemeinsam über den qualitativen Sprung von „Kampagne“ zu „Systemwandel“ reflektiert werden. Ablauf: • Vorstellungsrunde (20 Minuten) • „Glyphosat“ – Symptom einer Wachstumsgesellschaft: Was ist das Problem? (Impulsreferat & Diskussion, 60 Min) • Die Glyphosat-Kampagne: Entstehung, Erfolge, Misserfolge, „Lessons learned“ (Impulsreferat & Diskussion, 60 Min) • Von der Kampagne zum Systemwandel: Visionen, Voraussetzungen, Hindernisse (kurzes Input...
Lesezeit: < 1 MinuteGastbeitrag: Grüner Landraub durch Naturschutz
von Rene Vesper Hausarbeit bei Prof. K.-H. Erdmann, Geografisches Institut, Universität Bonn. Die Arbeit kann HIER herunter geladen werden. Nachstehend ein Auszug aus der Einleitung: Im 21. Jahrhundert blickt der globale Norden mit Demut auf die vergangenen zwei Jahrhunderte zurück, in denen im Zuge der Industrialisierung und Globalisierung die Ressourcen des Planeten in großem Stile ausgebeutet wurden. Während das Wissen um das Ausmaß globaler Umweltzerstörung zunimmt, wird der Ruf nach mehr Umweltschutz in der Öffentlichkeit lauter. Auch die weltweit größten Umweltschutz-Nichtregierungsorganisationen (NGOs) haben sich unlängst grüne Agenden auf die Fahnen geschrieben. Durch ein hohes Spendengeldaufkommen, eigene Umweltfonds, Umweltschutzprojekte und eigene Zertifikatsysteme haben sie einen großen Einfluss in Umweltdiskursen erlangt. Ihre Position im internationalen Umweltregime ist jedoch umstritten, da es in einigen ihrer Projekte zu gewaltvollen Vertreibungen und anderen Menschenrechtverletzungen kam (Schmidt-Soltau 2005, 284-285, In: Pedersen 2008, 32; CLA & VEG 2015). Da unlängst auch eine große Bandbreite von VertreterInnen aus der Industrie mit umweltfreundlichen Werbespots, Slogans und CSR-Umweltprojekten4 aufwarteten, stellt...
Lesezeit: 2 MinutenTagung im Mai: In neuen Territorien denken – statt Ausverkauf von Land
6. – 8. Mai 2016 Evangelische Akademie Bad Boll In neuen Territorien denken – statt Ausverkauf von Land Weltweit nimmt die Landkonzentration zu, während umverteilende Landreformen aus der Mode gekommen sind. Die Konsequenzen sind in unterschiedlicher Form überall spürbar: neue Abhängigkeiten, sinkender Handlungsspielraum und eingeschränktes Entwicklungspotential nicht nur für Bäuerinnen und Bauern, Akteure im ländlichen Raum, sondern für die breite Bevölkerung. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der weltweiten Entwicklungen wollen wir unter anderem mit Saturnino Borras (Den Haag), Caroline Callenius (Stuttgart), Nadja Charaby (Berlin), Kerstin Lanje (Aachen), Wolfgang Hees (Eichstetten), Angela Müller (Niederstetten) Luis Hernández Navarro (Mexiko), Uwe Hoering (Bonn), Stefan Ofteringer (Aachen), Victor Rodrigues (Portugal), Adriano Talles Reis (Brasilien) und Philian Zamchiya (Zimbabwe) diskutieren. Wo findet Landkonzentration statt? Welche Konsequenzen hat dies? Wie beeinflussen internationale Entscheidungen die regionalen Entwicklungen? Welche Zwänge und Dynamiken bestimmen Prozesse der Landkonzentration? Wo kann gegengesteuert werden? Können Agrarreformprojekte gesellschaftliche Veränderungen anstoßen und so für mehr Verteilungsgerechtigkeit und weniger Armut sorgen? Unter welchen Bedingungen ist dies...
Lesezeit: < 1 MinuteKein Wald vor lauter Bäumen (Beitrag zum „Tag des Waldes“ am 21.3.2016)
von Peter Clausing Weltweit verlangsamt sich die Abholzung. Neu angepflanzt werden allerdings riesige Monokulturen, die etlichen Millionen Menschen keine Lebensgrundlage mehr bieten. Inzwischen ist praktisch jeder Tag des Jahres ein Gedenk- oder Aktionstag. Die Liste bei Wikipedia ist entsprechend lang und bisweilen skurril. Wer würde schon vermuten, dass es einen »Tag der Blockflöte« und einen »Internationalen Tag des Eies« gibt? Der »Tag des Waldes«, der alljährlich am 21. März begangen wird, hingegen klingt seriös. Er wurde Ende der 1970er Jahre von der UN-Welternährungsorganisation (FAO) initiiert und hat ganz offensichtlich etwas mit Umwelt- und Naturschutz zu tun. Dieser Tag ist ein willkommener Anlass zu hinterfragen, wie die Waldschutzbemühungen heute aussehen, wer Nutzen daraus zieht und was das eigentlich ist – der Wald, der laut aktueller FAO-Statistik 30,6 Prozent der Landfläche der Erde bedeckt. Bei der Definition des Begriffs »Wald« scheiden sich die Geister unter anderem an der Frage, ob Baumplantagen als Wälder gelten können. Die FAO zählt sie mit, und diejenigen,...
Lesezeit: 9 MinutenZur Fehlbewertung von Glyphosat durch Behörden und Industrie
Am 2.März 2016 wurde gegen das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), die in Parma, Italien, ansässige Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA) und gegen die belgische Niederlassung von Monsanto, von der im Namen der „Glyphosate Task Force“ die Wiedergenehmigung des Pestizidwirkstoffs Glyphosat beantragt wurde, Strafanzeige erstattet. In einem Anhang zu dieser Anzeige wurde die fachliche Begründung für die in der Strafanzeige geäußerte Anschuldigung geliefert, dass Behörden und Industrie mit falschen Angaben versuchen, die Wiedergenehmigung von Glyphosat zu erreichen, obwohl dieses von der Krebsagentur der Weltgesundheitsorganisation (IARC) als „wahrscheinlich krebserregend beim Menschen“ eingestuft wurde.
Lesezeit: < 1 MinuteProfitables Ackergift
von Peter Clausing Das Verhältnis zwischen agrochemischer Industrie, landwirtschaftlichen Produzenten und Verbrauchern wirft nicht nur ein Schlaglicht auf den Zustand unserer Landwirtschaft, sondern auch auf den unserer Demokratie. Das lässt sich anhand des Streits um die weitere Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat, auch Bestandteil des Breitband-Unkrautvernichtungsmittels »Roundup«, zeigen, von dem bereits vor fünf Jahren bei einem Jahresumsatz von knapp 4 Milliarden US-Dollar etwa 610.000 Tonnen weltweit eingesetzt wurden. Eigentlich liegt es auf der Hand: Ökologischer Landbau ist klimafreundlicher und umweltverträglicher als die konventionelle Landwirtschaft. Eventuelle Mindererträge durch eine Umstellung auf ökologischen Landbau sind – je nach Kultur und Anbauverhältnissen – entweder überschaubar oder gar nicht vorhanden.1 Allerdings ist der Arbeitsaufwand im ökologischen Landbau in der Regel höher, was die Produktion verteuert. Doch angesichts von landwirtschaftlicher Überproduktion, Niedrigpreisen für konventionell produzierte Lebensmittel und der Tatsache, dass rund ein Drittel davon im Müll landet, fragt man sich, warum unsere Landwirtschaft nicht schon längst komplett auf Ökolandbau umgestellt wurde. Der macht derzeit statt dessen...
Lesezeit: 8 MinutenAgrarökologie – Definitionen, Kontext und Potenziale
von Peter Clausing – ursprünglich veröffentlicht auf globe-spotting.de im November 2015 – Vor einigen Jahren wurde Agrarökologie als „Wissenschaft, Bewegung und Praxis“ definiert (Wezel et al. 2009). Das bringt zum Ausdruck, dass das Konzept weitaus mehr beinhaltet als das, was in unseren Breiten landläufig hinter dem Begriff „Bio-…. “ gesehen wird. Die Bezugnahme auf „Bewegung“ bedeutet allerdings nicht, dass Agrarökologie automatisch mit gesellschaftlichem Umbruch und der Entstehung einer gerechteren Gesellschaftsordnung gleichzusetzen ist. Doch sicherlich ist sie ein ‚Trittstein’ auf dem Weg dorthin. Die ‚Scharnierfunktion’ der Agrarökologie zwischen Natur- und Gesellschaftswissenschaft existierte nicht von Anbeginn. Als der Begriff 1928 von dem sowjetischen Agronomen B.M. Bensin geprägt wurde, war damit ausschließlich Biologisches gemeint – das Zusammenleben von Organismen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen. Auch in der Tradition des Kieler Professors Wolfgang Tischler, der 1965 als erster ein Handbuch mit dem Titel Agrarökologie veröffentlichte, wird das Gebiet vornehmlich als biologisches Fach verstanden. Doch die Zeiten haben sich geändert. Francis et al (2003, 100) definierten diese...
Lesezeit: 6 Minuten