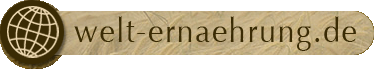Glyphosat-Krebsstudien an Mäusen – Argumente der EU-Behörde ohne Grundlage
Von Peter Clausing Am 12. November veröffentlichte die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit (EFSA) ihre Schlussfolgerung zur Bewertung des Herbizidwirkstoffs Glyphosat, der von der WHO-Agentur für Krebsforschung (IARC) als „wahrscheinlich krebserregend beim Menschen“ eingestuft wurde, was eine weitere Genehmigung dieses Wirkstoffs in Europa mit größter Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen hätte, wenn die EFSA sich dieser wissenschaftlich fundierten Bewertung angeschlossen hätte – hat sie aber nicht. Anfang Dezember 2015 wurde der entscheidende Teil der EFSA-Schlussfolgerungen, jene zu den Krebsstudien an Labormäusen, einer kritische Analyse unterzogen. Zu diesem 10-seitigen englischsprachigen Dokument gibt es jetzt die nachstehende deutsche Zusammenfassung. In allen fünf validen Krebsstudien an Mäusen wurde bei Anwendung des von der OECD empfohlenen Cochran-Armitage-Trend Tests eine signifikante Erhöhung der Tumorrate bei einem oder mehreren Tumortypen festgestellt, womit das Kriterium „ausreichende Nachweise beim Tier“, der CLP-Verordnung (1272/2008, Annex I; 3.6.2.2.3) erfüllt ist. Die EFSA bestreitet dies mit folgenden Argumenten: Fehlende statistische Signifikanz bei Anwendung paarweiser Vergleiche Diese Behauptung entbehrt der Grundlage. Die OECD empfiehlt seit 2012...
Lesezeit: 2 MinutenPrivate Stiftungen – Speerspitze der globalen Agrarkonzerne?
Von Peter Clausing Die „neuen Philanthropen“, wie sich die Milliardäre des 21. Jahrhunderts nennen, schaffen mit ihren Stiftungen unter Umgehung demokratischer Entscheidungsprozesse die Voraussetzungen für die Ausdehnung der Märkte transnationaler Konzerne. Verbrämt durch einen Diskurs der Armutsbekämpfung, fördern sie die Entstehung einer neuen agrarischen Mittelschicht im subsaharischen Afrika, die ausreichend zahlungskräftig ist, um sich die Segnungen einer neuen Grünen Revolution leisten zu können. Mangel an Demokratie ist eine wesentliche Voraussetzung dafür. Zwar behauptet die Grüne Revolution 2.0, dass sie die afrikanischen KleinbäuerInnen aus der Armutsfalle ziehen wolle, doch gerade diese profitieren nicht davon! Die eigentlichen Nutznießer des neuen landwirtschaftlichen Booms sind – wie Untersuchungen in Kenia und Sambia zeigen – reiche Städter, in der Mehrzahl Regierungsangestellte, die sich in die Landwirtschaft einkaufen. Das erste Anzeichen für eine neue „Grüne Revolution“ gab es 1997, als Gordon Conway, der kurz darauf zum Präsidenten der Rockefeller-Stiftung ernannt wurde, sein Buch „The Doubly Green Revolution: Food for All in the Twenty-first Century”, veröffentlichte (1)....
Lesezeit: 14 MinutenDie Glyphosat-Kontroverse
Zum Streit um die Wiederzulassung des Pflanzengiftes in der EU nach der WHO-Warnung vor Krebsgefahr Von Peter Clausing Anfang August teilte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (European Food Security Authority, EFSA) mit, man werde sich mehr Zeit als geplant für eine Empfehlung zur Neuzulassung des Unkrautvernichters Glyphosat lassen. Die Einschätzung der Experten werde nicht, wie ursprünglich vorgesehen, am 13. August abgegeben, sondern erst Ende Oktober oder Anfang November, sagte ein Efsa-Sprecher am 5. August am Sitz der Behörde im italienischen Parma. Pestizidwirkstoffe unterliegen in der Europäischen Union alle zehn Jahre einem Wiederzulassungsverfahren, bei dem alle neu hinzugekommenen Erkenntnisse über mögliche Risiken für Gesundheit und Umwelt zu berücksichtigen sind. Diese Regelung ist ein Erfolg des jahrzehntelangen Kampfes von Umweltorganisationen. Sie hat aber nur bedingt zu einer Reduzierung des Einsatzes von Giften in der Landwirtschaft beigetragen, die gegen Pflanzen (Herbizide), Schädlinge (Insektizide) oder Pilze (Fungizide) wirken. Die Terminverschiebung bei der EFSA ist ein Indiz dafür, dass hinter den Kulissen heftige Debatten stattfinden....
Lesezeit: 4 MinutenLandgrabbing
Auf den 5. Heppenheimer Tagen zur christlichen Gesellschaftsethik ging es um Fragen des Bodeneigentums aus unterschiedlichsten Perspektiven Thesen zum Thema Landgrabbing von Peter Clausing 1. Einerseits wird die Verabschiedung der freiwilligen Leitlinien der FAO (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security) im Jahr 2012 als großer Erfolg betrachtet, auch deshalb, weil diese Leitlinien sehr bald nach dem kritisierten Weltbankbericht zum Thema Landgrabbing (Deininger und Byerlee 2011) verabschiedet wurde. Andererseits kann Landgrabbing nicht losgelöst von anderen Politikfeldern betrachtet werden, die das Landgrabbing bedingen bzw. beeinflussen oder selbst vom Landgrabbing beeinflusst werden. Dazu gehören u.a.: – Handelspolitik allgemein, insbesondere aber die Liberalisierung von Börsengeschäften mit Nahrungsmitteln (Spekulation); – Politik bezüglich Ernährungsgewohnheiten (Fleischkonsum, Vergeudung von Lebensmitteln, Dumpingpreise); – Klima-, Energie- und Biodiversitätspolitik (Agrotreibstoffe, Landnutzungsänderungen, Schutzgebiete); – Förderung bestimmter Modelle landwirtschaftlicher Produktion (ungenügende bzw. nur Alibi-mäßige Förderung von Alternativen zu input-intensiver, profit-orientierter Landwirtschaft); – Migrationspolitik; – Informationspolitik (Beispiel: das Fehlen ökonomischer Hintergrundinformationen, inklusive...
Lesezeit: 10 MinutenViel Macht für wenige
Unter dem Titel »Wer hat die Macht?« wurde anlässlich des G-7-Gipfels eine Studie des Fair Trade Advocacy Office Brüssel zu Machtkonzentration und unlauteren Handelspraktiken in diesen Wertschöpfungsketten vorgelegt. Von Peter Clausing Wenn sich am 7. und 8. Juni die Staats- und Regierungschefs der G-7-Länder auf Schloss Elmau in Oberbayern treffen, wird auch die Gestaltung von Handels- und Lieferketten ein Gesprächsthema sein. Diese Strukturen werden gern als Wertschöpfungsketten bezeichnet, was suggeriert, dass alle Beteiligten etwas abbekommen. Besonders jene Prozesse, die unsere Ernährung berühren, spielen eine wichtige Rolle. Doch die »Wertschöpfung« ist ungleich verteilt. Am einen Ende der Kette befinden sich 2,5 Milliarden Menschen, deren Einkommen von der Landwirtschaft abhängt. Ein Großteil von ihnen trägt dazu bei, dass die globalen Warenströme fließen, oder wird von diesen beeinflusst. Am anderen Ende: 3,5 Milliarden Menschen, die in Städten leben und folglich ihre Lebensmittel kaufen müssen. Dazwischen agieren diejenigen, die den überwiegenden Teil des (Mehr-)Wertes abschöpfen: die Händler, die Aktionäre der Agrar- und Lebensmittelindustrie und...
Lesezeit: 3 MinutenLöst Glyphosat Krebs aus? – Wichtige Lücke in Risikobewertung deutscher Behörde
Hamburg und München, 15.04.2015. Eine aktuelle Recherche des Pestizid Aktions-Netzwerks (PAN Germany) deckt eine wichtige Lücke bei der Risikobewertung von Glyphosat durch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) auf. Demnach gibt es derzeit mindestens zehn Studien, die zeigen, dass Glyphosat in Zellen sogenannten „oxidativen Stress“ auslöst, der auch zur Krebsentstehung führen kann. Diesen Wirkungsmechanismus hat das BfR jedoch außer Acht gelassen. Dieses Versäumnis könnte ein Grund dafür sein, dass das BfR, anders als ein internationales Gremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO), zu dem Schluss kommt, dass Glyphosat nicht krebserregend ist. Der Toxikologe Dr. Peter Clausing, der für das Pestizid Aktions-Netzwerk e. V. (PAN Germany) die vorliegenden Studien bewertet hatte, kritisiert: „Das BfR geht nur auf zwei Publikationen zum Thema oxidativer Stress ein, allerdings nicht im Zusammenhang mit einer möglichen Krebsentstehung. Mindestens acht weitere Untersuchungen aus den Jahren 2005 bis 2013, die über die Erzeugung von oxidativem Stress durch Glyphosat an Wirbeltieren wie Fischen, Kaulquappen, Mäusen und Ratten berichten, fanden überhaupt keine Erwähnung. Befunde...
Lesezeit: 2 MinutenLandungerechtigkeit: Hunger und Migration
Der chronische Nahrungsmangel im subsaharischen Afrika hängt mit der Ungleichheit im Besitz von Grund und Boden zusammen. Eine Abwanderung in die Städte lindert die Not in der Regel nicht. Von Peter Clausing In den Ländern südlich der Sahara, dem sogenannten subsaharische Afrika, leben über 200 Millionen chronisch hungernde Menschen – das sind etwa 30 Prozent der dortigen Bevölkerung. Davon sind vor allem die auf dem Land lebenden Menschen betroffen, für die »chronischer Hunger« zumeist bedeutet, dass er alljährlich wiederkehrt, nämlich dann, wenn die eigenen Vorräte zur Neige gehen und das Geld nicht reicht, um zusätzliche Lebensmittel zu kaufen. Diese Periode kann mehrere Wochen bis mehrere Monate dauern – je nachdem wie die vorherige Ernte ausfiel. Typisch ist das für Betriebe, bei denen die landwirtschaftlich bearbeitete Fläche unter einer Größe von zwei Hektar liegt. 80 Prozent der afrikanischen Bäuerinnen und Bauern bewirtschaften derart kleine Flächen und ernähren damit mehr schlecht als recht eine oftmals sechs- bis achtköpfige Familie. In Malawi zum...
Lesezeit: 9 MinutenDie lange Grüne Revolution
von Raj Patel In einer 63-seitigen Analyse, die Anfang 2013 erschien, beschäftigt sich der britische Soziologieprofessor Raj Patel faktenreich mit den Mythen der Grünen Revolution. Der nachstehende Text ist zugleich Auszug und Kondensat dieser umfangreichen Übersichtsarbeit. Historisch betrachtet erstreckte sich die Grüne Revolution über die Zeit von 1940 bis 1970, auch wenn die Prozesse der kapitalistischen Akkumulation, Enteignung, Investition und Innovation in der Landwirtschaft – die erst zwei Jahre vor ihrem offiziellen Ende „Grüne Revolution“ genannt wurden – bereits früher stattfanden und sich weit über 1970 fortsetzten. Die Väter der Grünen Revolution konnten ihre Ziele nicht beliebig durchsetzen, sondern mussten unter Nutzung staatlicher Mittel den oftmals kollektiv organisierten Widerstand der armen ländlichen Bevölkerung überwinden. Um die Grüne Revolution zu verstehen, sollte man sie als biopolitischen und geopolitischen Prozess verstehen, für den die Rockefeller-Stiftung zunächst Mexiko als Experimentierfeld auswählte. Das Ganze begann, als der US-Vizepräsident Henry Wallace, zugleich Gründer des heutigen Saatgutkonzern Pioneer Hi-Breed, im November 1940 an der Amtseinführung des...
Lesezeit: 6 MinutenEin diskursives Hungergespenst
von Peter Clausing Nicht selten ruft die Frage, ob und unter welchen Bedingungen die wachsende Weltbevölkerung ausreichend ernährt werden kann, Ratlosigkeit und Unbehagen hervor. Eine negative Antwort würde den Hungertod Hunderter Millionen Menschen mit kaum vorstellbaren gesellschaftlichen Folgen bedeuten. Schließlich sind schon heute zirka 850 Millionen Menschen unterernährt, was bedeutet, dass alljährlich etwa 10 Millionen Menschen an Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen sterben. Die Frage, was getan werden müsste, um bei gleichzeitig wachsender Weltbevölkerung von diesem Genozid wegzukommen, wird sehr unterschiedlich beantwortet. Zunächst ist festzuhalten, dass ein allgemeiner Konsens darüber besteht, dass die Weltbevölkerung nach 2050 nur noch unwesentlich zunehmen wird. Zwar werden in 35 Jahren voraussichtlich zwei Milliarden (30 Prozent) mehr Menschen auf der Erde leben als heute, jedoch bei stetig abnehmendem Bevölkerungswachstum. Nun vertreten Weltbank und Welternährungsorganisation (FAO) die Ansicht, dass dann, wenn 30 Prozent mehr Menschen die Welt bevölkern, 70 Prozent mehr Nahrungsmitteln zur Verfügung stehen müssten. Die Diskrepanz zwischen den 70 und 30 Prozent wird mit...
Lesezeit: 3 MinutenDas Stickstoff-Dilemma
Von Peter Clausing Im Jahr 1910 ließen sich die BASF ein chemisches Verfahren zur Ammoniaksynthese aus Stickstoff und Wasserstoff patentieren. Das von den späteren Nobelpreisträgern Fritz Haber und Carl Bosch entwickelte Verfahren stellt laut Wikipedia das „bedeutendste industrielle Verfahren zur Umwandlung des unreaktiven Luftstickstoffs in eine nutzbare Stickstoffverbindung (dar)“. Dies ist ein energieintensiver Prozess, bei dem Temperaturen von 500 Grad Celsius erforderlich sind. Seine erste Konjunktur hatte das Haber-Bosch-Verfahren im Ersten Weltkrieg, als große Mengen von Ammoniak zur Herstellung von Munition und Sprengstoff benötigt wurden. Die Namensgeber des Verfahrens standen voll und ganz in deutsch-militaristischer Tradition. Fritz Haber gilt als „Vater des Gaskrieges“ im Ersten Weltkrieg und der jüngere Carl Bosch war während der Nazizeit „Wehrwirtschaftsführer“, also Spitzenfunktionär der NS-Kriegswirtschaft. Ähnlich wie zu anderen Anlässen – man denke an die Atomindustrie – wurden nach Kriegsende neue Absatzmärkten gesucht. Es begann die Ära des synthetischen Düngers. Heute wird der Mythos gepflegt, dass die Ernährung der Hälfte der Weltbevölkerung von diesem Dünger...
Lesezeit: 6 Minuten